TPremiere in Deutschland: Dow verschließt Salzkaverne mit neuer Methode

Die K12 in Ohrensen wurde kürzlich verschlossen. Hierfür benötigten die Profis jede Menge Geräte. Foto: Dow
Die Kaverne 12 in Ohrensen hat ausgedient. Die Dow hat sie durch ein neues norwegisches Verfahren verschließen lassen - und so funktioniert‘s.
Ohrensen. Auf der Stader Geest wurde ein Stück Technikgeschichte geschrieben: Erstmals in Deutschland kam beim Verschluss einer Salzkaverne das patentierte PWC-Verfahren (Perforate, Wash and Cement) zum Einsatz. Die Methode der Firma HydraWell ist weltweit bereits vielfach erprobt und verspricht ein effizienteres Arbeiten. Nun fand sie mit der Stilllegung der Kaverne 12 (K12) auf dem Gelände der Dow in Ohrensen ihre deutsche Premiere.
Tonnenweise Salz landen täglich in Stade
Seit Beginn der 1970er Jahre betreibt die Dow in Harsefeld eines der größten Salzabbaugebiete Europas. Von hier aus wird über eine 27 Kilometer lange Leitung die für die chemische Produktion in Stade-Bützfleth benötigte Salzsole transportiert - bis zu 600 Tonnen pro Stunde. Doch auch eine Salzkaverne hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn sie vollständig ausgespült ist, muss sie dauerhaft verschlossen und das Gelände anschließend renaturiert werden.
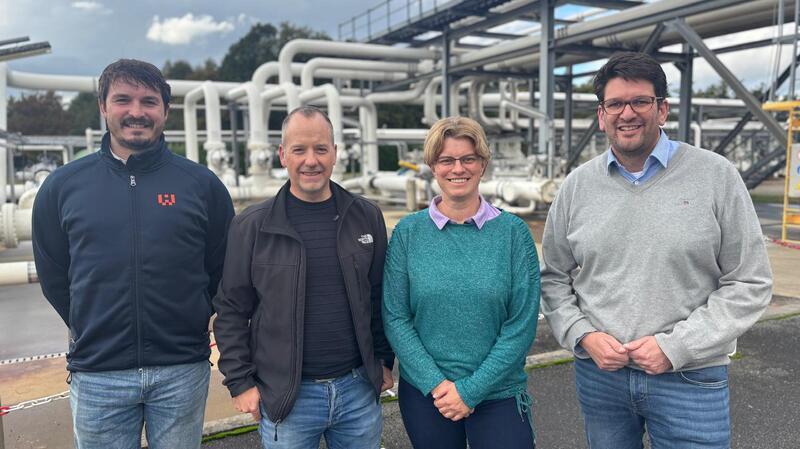
Freuen sich über gute Zusammenarbeit (von links): Maarten Bekker von HydraWell und Bas Kaldenbach von Well Engineering Partners sowie Dow-Projektmanagerin Silke van Lier und Betriebsleiter Henrik Harz. Foto: Pauline Meyer
So geschah es nun mit der Kaverne 12, die 1982 errichtet wurde. Bevor der Verschluss eingeleitet werden konnte, ruhte die K12 rund zehn Jahre lang. Die Sole musste sich erst der Gebirgstemperatur anpassen, damit sich das Volumen nach Verschluss nicht zusammenzieht, erklären die Profis vor Ort.
Lokale Unternehmen helfen beim Verschluss
„Wir freuen uns, die nächste Kaverne auf den Weg zurück zur Natur zu schicken“, sagt Projektmanagerin Silke van Lier. Der Verschluss markiert zugleich den Beginn einer neuen technischen Ära: Statt der herkömmlichen, aufwendigen Methode, bei der das Rohr von innen ausgefräst und der gesamte Hohlraum mit Beton gefüllt wird, wurde erstmals das effizientere PWC-Verfahren eingesetzt.
Wasserstoff
T Scheitert die Stader Energieregion an der Bürokratie?
24-Stunden-Reportage
T Nachtschicht bei der Dow: Wo die Lichter nie ausgehen
Und wie funktioniert das? In rund 1500 Metern Tiefe wird zunächst ein Stopfen im Bohrrohr gesetzt. Anschließend schlitzt das sogenannte Gator-Tool von innen viele präzise Löcher in das Rohr. Durch diese Öffnungen wird im Anschluss mit Hochdruck eine spezielle Spülflüssigkeit in den Hohlraum gepresst, um alle Rückstände zu entfernen. Danach wird über ein weiteres Werkzeug Zement mit hohem Druck durch die Perforationen gepumpt. So entsteht unterirdisch ein 360-Grad-Zementblock, der die Kaverne dauerhaft abdichtet.
Mega-Investition
T Neue Rettungswache der Dow: Ein Traum für jeden Feuerwehrmann
Fachkräfte von morgen
T Neues Ausbildungslabor: Dow investiert 2,1 Millionen in Stade
Der verwendete Zement ist auf hohe Temperaturen, Druck und salzhaltige Umgebungen ausgelegt. „Das Verfahren erfordert eine genaue Planung und präzise Durchführung, damit alles reibungslos funktioniert“, betont van Lier.
Nach längeren Vorbereitungen dauerten die Arbeiten, an denen insgesamt 25 Unternehmen beteiligt waren, rund zwei Wochen. Unterstützung gab es auch durch Unternehmen aus der Region. „Wir bedanken uns bei allen Beteiligten. Toll, dass die Zusammenarbeit auch mit den lokalen Firmen so unkompliziert und flexibel funktioniert hat“, so Silke van Lier.
Bergbauamt gab dem Vorhaben seinen Segen
Bevor das Verfahren der norwegischen Firma HydraWell in Deutschland angewendet werden durfte, musste die Dow eine Genehmigung des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie einholen.

Am oberen Bildrand sieht man die K12 von oben: Das Luftbild ist bereits einige Jahre alt. Foto: Pauline Meyer / Dow
Unterstützung kam von der niederländischen Partnerfirma Well Engineering Partners, die weltweit Erfahrung mit Bohrloch-Verschlüssen hat. „Wir hatten bereits gute Erfahrungen mit HydraWell gemacht“, erklärt Bas Kaldenbach von Well Engineering Partners. „Das Vertrauen war also da.“
Wo die K12 war, werden bald Pferde grasen
Nach Abschluss der Arbeiten wird die Oberfläche wiederhergestellt: Der Betonplatz wird rückgebaut, das Gelände renaturiert. Wo sich die K12 bislang befand, soll in den kommenden zwei Jahren eine Pferdeweide entstehen. So wie schon bei der nahe gelegenen Kaverne K9, die inzwischen wieder als Waldfläche begrünt ist. „Nachhaltiges Handeln ist eines unserer wichtigsten Unternehmensziele“, erklärt Betriebsleiter Henrik Harz.
Weniger Aufwand: Norwegisches Verfahren überzeugt
Gegenüber der bisherigen Methode, bei der das Rohr im Inneren aufwendig ausgefräst wurde, bietet das neue Verfahren deutliche Vorteile: Es spart Zeit, Kosten und Transportaufwand und ist zugleich besser kontrollierbar.
Branche in der Krise
Dow schließt Chemieanlagen in Sachsen und Sachsen-Anhalt
Maritime Wirtschaft
T 350 Millionen Euro: So soll der Stader Hafen ausgebaut werden
Zukunftstechnologie
T Neue Salzkavernen in Harsefeld sollen als Wasserstoff-Speicher dienen
Die gesamte Schließung dauerte nur rund zwei Wochen - ein Bruchteil der Zeit, die herkömmliche Verfahren beanspruchen.
Mit der erfolgreichen Premiere in Ohrensen sieht sich die Dow gut aufgestellt für künftige Kavernen-Verschlüsse. „Jedes Bohrloch ist anders, aber wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Silke van Lier.

Unauffällig und umgeben von Pflanzwällen und Pferdeweiden: Die K12 war von weitem kaum zu erkennen. Bald soll an ihrer Stelle eine Pferdeweide entstehen. Foto: Pauline Meyer
Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.


















