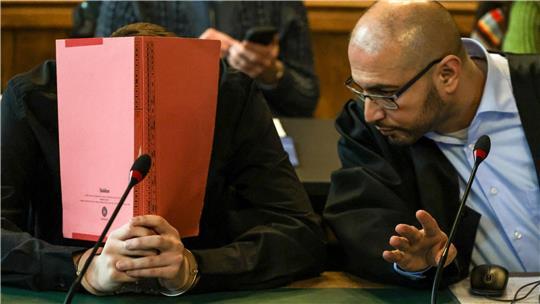T„Steigende Zahl von Gewalt unter Kindern gibt Anlass zur Besorgnis“

Unter Jugendlichen wird vermehrt nicht nur zugeschlagen. "Corona kann höchstens ein Teil der Erklärung sein, da die Jugengewalt schon vor der Pandemie angestiegen ist", sagt Susann Prätor. Foto: dpa
Susann Prätor ist Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen. Im Interview spricht sie über die steigende Gewalt unter Jugendlichen, die Gründe und wie man dagegen vorgehen kann.
Frau Prätor, Sie berichten, dass die Kriminalität insgesamt seit 2022 um 5,5 Prozent zugenommen hat. Im selben Zeitraum hat die Zahl der Straftaten von Jugendlichen – ohne Verkehrsdelikte – zugenommen. Woran liegt das?
Durch die Corona-Pandemie war es erwartbar, dass die Zahlen in den Jahren 2020 und 2021 nach unten gehen, denn durch die vielen Einschränkungen gab es auch nicht so viele Möglichkeiten, sich zu begegnen und eben schlimmstenfalls Gewalttaten zu begehen.
Eigentlich sehen wir hier einen Trend, der seit 2015 anhält und langsam, aber kontinuierlich nach oben zeigt bei den 14- bis 18-Jährigen.
Davor hatten wir jahrelang eine sinkende Tendenz bei der Jugendgewalt.
Genau, von 2006 bis 2015 war es so. Das war offensichtlich ein Ergebnis der Tatsache, dass im Jahr 2000 das elterliche Züchtigungsrecht abgeschafft wurde.
Das hat in der Bevölkerung etwas verändert, die Akzeptanz von Elterngewalt ist wesentlich geringer geworden, das veränderte Verhalten der Eltern färbt dann auch auf die Kinder ab.
Häufig hört man von der Idee, dass die Pandemie auch an den steigenden Gewalttaten unter Jugendlichen schuld sei. Ist da etwas dran?
So einfach ist die Erklärung auf den steigenden Trend seit 2022 leider nicht. Corona kann höchstens ein Teil der Erklärung sein, da die Jugendgewalt schon vor der Pandemie angestiegen ist. Zum Beispiel gab es in der Schweiz niemals so starke Einschränkungen wie bei uns, dort wurden nie für längere Zeit flächendeckend die Schulen geschlossen.
Gewalt an Schulen
T Messer im Ranzen: Zahl der Gewaltfälle in Schulen steigt - auch in Niedersachsen
Staatsanwaltschaft
Lebenslang für Messerangriff in Brokstedt gefordert
Und dennoch steigen auch in der Schweiz die Zahlen an. Und was uns wirklich zu denken gibt: Es war erwartbar, dass die Zahlen auf das Niveau vor Corona, also im Jahr 2019, steigen. Sie steigen allerdings über das Niveau von 2019 und dafür müssen wir nach den Ursachen suchen. 2019 hatten wir 6000 Tatverdächtige auf 100.000 Jugendliche, in 2023 sind wir bei knapp 7000 Tatverdächtigen auf 100.000 Jugendliche.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und Jugendgewalt?
Es sind eher die Lebensumstände, weniger die Herkunft. Sonst könnte man ja an alle einen deutschen Pass verteilen und dann wären die Probleme gelöst. So ist es aber nicht. Die gute Nachricht ist aber nach wie vor: Die ganz überwiegende Mehrheit aller Jugendlichen tritt nicht polizeilich in Erscheinung.
Dennoch gibt es abweichende Zahlen: Bei deutschen Jugendlichen werden sechs von 100 straffällig, bei nichtdeutschen sind es elf von 100. Das liegt wie gesagt an den Umständen, zum Beispiel soziale Benachteiligung und Gewalt in der Familie.
Gewalt in der Familie wird ja oft nicht angezeigt, ganz anders als zum Beispiel ein Wohnungseinbruch oder Versicherungsbetrug.
Genau, nicht alle Straftaten werden gleichermaßen angezeigt und das kann natürlich auch die Zahlen verzerren. Und deswegen sind die Ursachen auch so schwer greifbar. Was wir aber sehen, ist eine Zunahme von gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen insbesondere seit 2017, sowohl bei Deutschen wie auch bei Migranten.
Das zeigen sogenannte Dunkelfeldstudien, bei denen Jugendlichen in der neunten Klasse Aussagen vorgelegt werden, denen sie zustimmen können oder auch nicht. Wir machen diese Umfragen alle zwei Jahre. Dort wird zum Beispiel gefragt: Hast du schon mal jemanden geschlagen?
Staatsanwaltschaft
Lebenslang für Messerangriff in Brokstedt gefordert
War die Person verletzt? Am häufigsten kommen leichte Körperverletzungen vor, einer schlägt einen anderen. Von schwerer Körperverletzung sprechen wir, wenn mehrere Personen involviert sind und Waffen ins Spiel kommen. Das wird natürlich auch nicht so ohne Weiteres zugegeben.
Welche Rolle spielt die Schule in diesem Zusammenhang?
Die Schule ist ein Raum, in dem die Kinder lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wenn elterliche Gewalt in den eigenen vier Wänden ein Thema ist, dann ist die Schule ein Schutzraum. Und noch etwas anderes ist zu beobachten: Seit 2015 wird häufiger die Schule geschwänzt.
Das ist ganz klar ein Risikofaktor für Jugendgewalt. Es zeigt, dass die Eltern keine Autorität bei den Kindern haben und sie nicht kontrollieren können. Das sind oft sehr schwierige familiäre Verhältnisse.
Wie bewerten Sie die Auswirkungen von Ballerspielen?
In der Pandemie hat der Medienkonsum nachweislich zugenommen. Und ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ballerspielen und der Senkung von Empathie, aber das sind kurzfristige Effekte. Wenn Kinder in einem liebevollen Elternhaus aufwachsen, dann haben Ballerspiele keine Auswirkungen.
Anders ist es dagegen, wenn Kinder vernachlässigt werden. Dann können sie sich schon mal in Computerspielen verlieren und vernachlässigen eventuell ihre sozialen Kontakte und ihre Hausaufgaben.
Wie kann man wirkungsvoll Prävention betreiben?
Die gute Nachricht ist ja: Man kann etwas gegen Gewalt tun! Prävention bedeutet, dass man auch in den Schulen Aufklärung anbietet, dass Lehrerinnen und Lehrer Vorbilder sind und eventuell auch Medienkompetenz vermitteln können. Es gibt Schulsozialarbeiter und auch Schüler werden ausgebildet, um in Schulen als Konfliktschlichter aufzutreten.
Das Geheimnis von Prävention ist: Je früher sie ansetzt, desto wirkungsvoller ist sie. Es gibt Programme wie „Faustlos“, bei denen Kinder lernen sollen, die Gefühle anderer Menschen zu interpretieren. Das beginnt schon im Kindergarten, im Alter von drei bis vier Jahren.
Bei so vielen Ansätzen wäre es in der Tat erwartbar, dass die Zahlen sinken anstatt zu steigen …
Noch mal: 99 Prozent der Jugendlichen treten polizeilich nicht mit einer Gewalttat in Erscheinung, mit dem Dunkelfeld sind es immer noch 93 Prozent. Aber das ist für viele eben nicht berichtenswert.
Aber der Anstieg, den wir sehen, ist eben auch keine Eintagsfliege und man kann nicht sagen, dass das unproblematisch wäre. Dabei darf man aber auch nicht vergessen: Wir hatten auch im Jahr 1998 schon einmal ein recht hohes Niveau mit etwas über 8000 Tatverdächtigen pro 100.000 Jugendlichen.
Norddeutschland
T Bremerhaven: Chat unter Jugendlichen endet mit Messerattacke
Kriminalität
Schüler soll Ex-Freundin erstochen haben
Was derzeit Anlass zur Besorgnis gibt, ist die steigende Zahl von Gewalt unter Kindern, hier sprechen wir von den Zehn- bis 13-Jährigen. Das ist ungewöhnlich mit einer zunehmenden Anzahl von Taten, bei denen Leib und Leben in Gefahr sind. Dennoch treten aber 99,6 Prozent der Kinder polizeilich nicht in Erscheinung.
Gibt es eine Brutalisierung bei der Jugendgewalt?
Nein, dafür gibt es keine empirischen Belege, tatsächlich ist die Zahl der sogenannten „Raufunfälle“ deutlich rückläufig. Wohl aber gibt es sehr viel mediale Berichterstattung über besonders dramatische Fälle und natürlich deren Verbreitung in den sozialen Medien.
Wie bewerten Sie beim Thema Jugendgewalt den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen?
Das war und ist wohl zu allen Zeiten der gravierendste Unterschied. In 2023 hatten wir 1580 männliche Tatverdächtige, aber nur 324 weibliche. Man kann sagen: Wir haben ein Männerproblem. Frauen suchen eher Unterstützung oder haben autoaggressive Formen.
Zur Person
Susann Prätor hat Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften (Magister) an der Technischen Universität Dresden studiert. Von 2006 bis 2012 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen.
Ihre Arbeitsschwerpunkte dort waren Kinder- und Jugendkriminalität , Migration und Kriminalität sowie Gewalt gegen ältere und pflegebedürftige Menschen. Im Jahr 2011 wurde sie an der Universität Bremen promoviert.
Von 2012 bis 2022 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kriminologischen Dienst im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges. Ihre Themenschwerpunkte lagen dabei im Bereich des Jugend- und Frauenstrafvollzuges und dem Ausstieg aus der Kriminalität.
Susann Prätor lehrt seit 2016 das Modul Kriminologie in einem Qualifizierungsprogramm des Landespräventionsrates Niedersachsen, das sich an Polizei, Sozialarbeiter und andere mit Prävention befassten Institutionen richtet.
Seit 2022 ist sie als Professorin im Studiengebiet Sozialwissenschaften/Führung an der Polizeiakademie Niedersachsen tätig. Die 42-Jährige ist verheiratet und Mutter von drei Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren.
Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel erscheint in Kooperation mit der Nordsee-Zeitung.