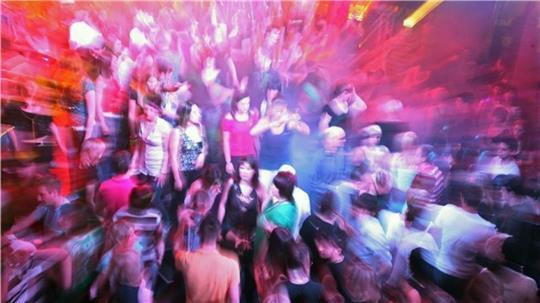TWarum Bauern jetzt wieder auf Bäume setzen

Ein Beispiel für Agroforst: Bäume und Ackerkulturen können miteinander. Die maschinelle Bewirtschaftung wird nicht eingeschränkt. Foto: BZ
Agroforstwirtschaft ist kein neuer Trend, sondern eine uralte Methode. Doch in Deutschland geriet sie lange in Vergessenheit – bis jetzt.
Agroforstwirtschaft ist steinalt. Bereits in der Jungsteinzeit, als der Mitteleuropäer vor rund 8000 Jahren sesshaft wurde, betrieb er Agroforstwirtschaft. Will heißen, die Menschen nutzten Triebe und Blätter von Bäumen als Viehfutter. Bis ins 18. Jahrhundert wurde derlei hierzulande betrieben.
Seit dem Mittelalter graste Vieh auf Streuobstwiesen, wurden Schweine zur Eichelmast in Wälder getrieben. Was in anderen Teilen der Welt nach wie vor betrieben wird, ist in Deutschland im Zuge der Intensivierung und Rationalisierung der Landwirtschaft nach und nach fast vollständig verschwunden.
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und später die EU haben den Strukturwandel in der Landwirtschaft massiv vorangetrieben. Am Ende dieses Irrwegs sind Biotope verschwunden, die Landschaft ist ausgeräumt, weil Bäume und Sträucher beim Wirtschaften stören und keinen Ertrag bringen. Das Artensterben vollzieht sich rasant, das Grundwasser ist großflächig belastet. Intensivtierhaltung befördert den Klimawandel. Nährstoffe aus der Landwirtschaft zerstören Lebensräume in Nord- und Ostsee.
Agroforstsysteme sind in Frankreich und der Schweiz etabliert
Nun, da sich die Folgen des Raubbaus beispielsweise als Insektensterben, als Vogelsterben, als Extremwetter, als Bodenerosion bemerkbar machen und vor allem zu Ernteausfällen führen, setzt ein Umdenken ein. Als eine Möglichkeit, nachhaltiger zu wirtschaften, gilt Agroforstwirtschaft - also Bäume und Ackerkulturen, Weiden oder Wiesen miteinander zu kombinieren, damit Natur, Klima und des Bauern Geldbeutel profitieren.
Deutschland ist auf diesem Feld - wie auf vielen anderen - Nachzügler. Die Vorteile von Agroforstwirtschaft haben Franzosen und Schweizer lange erkannt. In Deutschland rühren Experten und Regierung neuerdings die Werbetrommel für dieses System der Landnutzung. Seit zwei Jahren lockt Vater Staat Landwirte mit Geld.
Eine typische Agroforstfläche könnte laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft so aussehen: Ein Schlag, auf dem Weizen wächst, wird in 50 Meter breite Streifen geteilt. Zwischen diesen Streifen werden Bäume in einer oder mehreren Reihen gepflanzt - beispielsweise Walnuss- oder Apfelbäume. Wiesen und Weiden können ebenso aufgeforstet werden. Auch Pappeln bieten sich als Agrobäume an. Der Forstlandwirt kann Wertholz, Nüsse, Obst oder Brennholz ernten.
Fördergeld bringt Vor- und Nachteile in die Waage
Erwiesenermaßen verbessern Bäume das Mikroklima auf dem Feld, sie verringern die Verdunstung, sie kühlen, schützen vor Wind, tragen zum Humusaufbau bei, dienen dem Grundwasserschutz, speichern Kohlendioxid, bieten Lebensraum - und nicht zuletzt einen optischen Reiz inmitten der Maismonotonie.
Diesen mannigfachen Vorteilen für den Bewirtschafter, den Grundeigentümer, die Gesellschaft stehen unzweifelhaft Aufwände gegenüber: Agroforst kostet Geld und Zeit, bindet Kapital, verringert die Fläche für den Anbau von Ackerkulturen und beeinträchtigt das Pflanzenwachstum in unmittelbarer Nachbarschaft.
Daher gewährt der Staat finanzielle Unterstützung: Das Bundeslandwirtschaftsministerium stellt für die Neuanlage eines Agroforstsystems zwischen 4500 und 9000 Euro pro Hektar Gehölzfläche zur Verfügung. Dazu kommen jeweils auf drei Jahre 1175 Euro pro Jahr und Hektar Gehölzfläche für Pflegemaßnahmen und 1000 Euro jährlich als pauschale Aufwandsentschädigung.