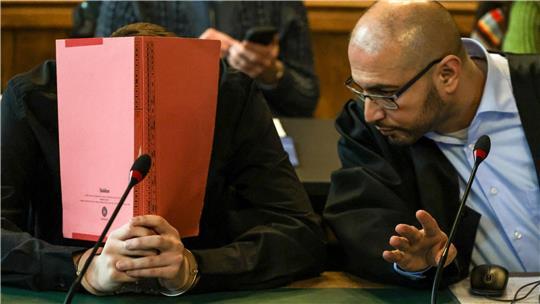TWie schwierig ist es heutzutage, Landwirt zu sein?

Die Familie Gäting betreibt Milchviehwirtschaft in Abbehausen in dritter Generation. Hergen Gäting (Mitte) und seine Söhne Gerben (links) und Torge sind mit Leib und Seele Landwirte. Auch wenn die Politik es ihnen nicht gerade leicht macht. Foto: Krabbenhoeft
Der Besuch eines Bauernhofes war in der Kindheit ein Riesenspaß. Welche Arbeit tagtäglich dahintersteckt, blieb verborgen. So ist die Lage bei einer Familie, die einen Milchbetrieb in dritter Generation führt.
Anfang des Jahres machten die Landwirte in der Wesermarsch durch Proteste auf ihre wirtschaftliche Lage und die erdrückende Bürokratie aufmerksam.
Die niedrigen Preise für ihre Produkte und ständig neue Auflagen sind nur einige Themen, die ihre Existenz bedrohen.
Der Milchpreis schwankt
Die Familie Gäting betreibt in Abbehausen zwei Milchviehbetriebe. Der Hof am Kurfürstendamm wird von Andrea und Hergen Gäting und ihrem 23-jährigen Sohn Gerben geführt. Die zweite Hofstelle Infeld hat die Familie vor knapp vier Jahren gekauft. Sie wird durch den 27-jährigen Sohn Torge geführt.
Beide Söhne sind Landwirtschaftsmeister. Wenn ihr Vater in Rente geht, wird Gerben den elterlichen Hof übernehmen. Die Familie bewirtschaftet 230 Hektar, die sie vornehmlich als Weideland und für den Maisanbau nutzt.
„Momentan kommen wir ganz gut klar“, sagt Hergen Gäting. Der Milchpreis liegt aktuell bei 46 Cent pro Liter. Innerhalb eines Jahres schwankt der gezahlte Betrag allerdings beträchtlich. Zwischen April 2014 und Oktober 2021 lag er laut der Internetplattform Statista die meiste Zeit weit unter 40 Cent pro Liter. Einen Höchstwert erreichte er für wenige Monate 2022 mit 60 Cent.
Kühe stehen im offenen Stall
Der Betrieb nimmt am Weidemilchprogramm teil. Dafür müssen die Kühe an 120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden täglich Zugang zur Weide haben. Dieser Beitrag zum Tierwohl schlägt mit 1,5 Cent extra pro Liter zu Buche.
Als die Eltern von Hergen Gäting den Betrieb aufbauten, hielten sie 20 Kühe. Die standen ganzjährig angebunden im Stall. Gemolken wurde von Hand. „Meiner Mutter bescherte das einen kaputten Rücken“, sagt der Landwirt. Damit die Familie von der Wirtschaft leben konnte, musste der Hof wachsen. Heute stehen 280 Kühe in einem offenen Laufstall, mit weichen Liegeboxen.
Anträge werden immer komplizierter
Doch die Politik bleibt ein Problem. „Wir haben keine Planungssicherheit. Wenn wir den Kuhstall umbauen wollen, kann uns keiner sagen, ob das in zehn Jahren noch den Regeln entspricht. Der Bank, die uns einen Kredit gibt, ist das egal“, sagt Gerben Gäting.
Dazu kommen Berge an Papier. Denn alles muss termingerecht dokumentiert werden. Aufgrund der Datenschutzauflagen müssen die Formulare teilweise mehrfach für die verschiedenen zuständigen Stellen ausgefüllt werden. Ebenso aufwendig sind die Anträge für Prämien und Subventionen. Und sie werden inhaltlich immer komplizierter.
„Wir nehmen bisweilen einen externen Berater in Anspruch. Der kennt sich mit den Feinheiten aus“, sagt Hergen Gäting. Dabei hat die Familie eigentlich genug zu tun. Um 5 Uhr heißt es: aufstehen zum Melken. Um 8 Uhr gibt es Frühstück. Es folgt das Füttern der Kühe und die Boxenpflege. Die Tierkontrolle und Arbeiten auf dem Land sind zu erledigen und um 16.30 Uhr geht es wieder in den Stall zum Melken.
Regeln ändern sich im Schnelltakt
Bis vor einigen Jahren dürften die Landwirte in den trockenen Wintermonaten Gülle ausbringen. Auf dem harten Boden sackte der Trecker nicht ein und die Ammoniakverluste sind bei kühlen Temperaturen geringer, mehr Nährstoffe gelangen in den Boden. Doch die Regeln haben sich geändert: Vom 1. November bis 31. Januar ist das Düngen von Weideland untersagt.
Fällt auch im Herbst und Frühjahr viel Regen, können die Bauern die Böden nicht befahren. Sie müssen warten, bis alles abgetrocknet ist. Die notwendigen Arbeiten geraten in Verzug. Um die Gülle bodennah aufzubringen, ist zudem die Verwendung bestimmter Technik vorgeschrieben. Die Gätings arbeiten mit einem Schleppschuh. Auch diese Anschaffung hatte ihren Preis.
Das Land verliert an Wert
Ein Problem der Wesermarsch ist der lehmige Boden, der das Wasser nur langsam einsickern lässt. Um den Stau an der Oberfläche zu verhindern, wird der Boden umgegraben und anschließend in die Form eines kleinen Hügels gewalzt. Der aufprallende Regen fließt zu den Seiten und in die Gräben ab. Aber kürzlich erlassene Auflagen untersagen dieses Vorgehen in bestimmten Gebieten. Die Weidenflächen verlieren durch die Auflagen und die damit verbundene eingeschränkte Nutzung an Wert.
„Die Gesetzgeber haben den Bezug zur Landwirtschaft verloren. Wir sind gelernte Landwirte. Unser Hof ist unser Kapital. Wir wissen, wie es am besten geht. Aber unsere Erfahrung ist nicht gefragt“, sagt Hergen Gäting. Trotzdem habe er es nie bereut, sich für den Betrieb entschieden zu haben.
Und sein Sohn Torge fasst zusammen: „Auf dem Hof ist es ganz anderes Arbeiten als beispielsweise auf einem Werk. Bei Sonnenaufgang draußen zu sein, wenn das Gras noch feucht ist und die Kühe auf die Weide laufen, das ist einfach herrlich.“
Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird in Kooperation mit der Nordsee-Zeitung veröffentlicht.