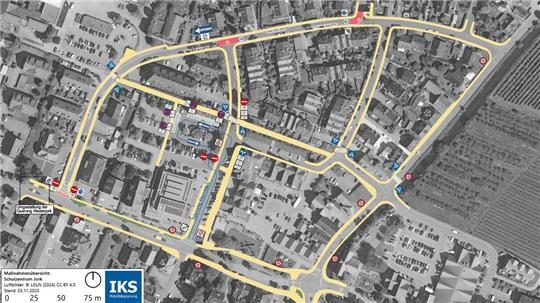TWarum die EU für den Öko-Obstbau überlebenswichtig ist

Obstbauer Peter Rolker (70) aus Jork-Ladekop ist Vizepräsident des Europäischen Bioobst-Forums. Im Sommer gibt er sein Amt ab. Foto: Vasel
Er gehörte zu den ersten Öko-Bauern im Alten Land - und er ist glühender Verfechter der EU. Peter Rolker aus Ladekop ist überzeugt, dass sich Bio-Obstbau ohne die EU nie so gut entwickelt hätte.
Jork. „Unsinn“, sagt Peter Rolker angesprochen auf einen „Dexit“, einen deutschen Austritt aus der Europäischen Union, angelehnt an den Begriff Brexit. Einen Austritt der Bundesrepublik aus der EU hat die AfD regelmäßig ins Spiel gebracht.
Rolker kontert mit Zahlen: Er führt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft an. Demnach würde ein EU-Austritt Deutschlands fast 2,5 Millionen Arbeitsplätze und 690 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten.
Lesermeinung
TAGEBLATT-Umfrage: Was bedeutet Europa für Sie?
Einbruch bei den Einkommen der Obstbauern in Großbritannien
Der Ökoobstbauer verweist beim Thema EU-Austritt auf die Erfahrungen seiner Kollegen in Großbritannien. Zeitweise hätten Supermarktketten Obst und Gemüse rationieren müssen. Auf Plantagen vergammelte Obst, weil mehrere 10.000 Erntehelfer fehlten.
EU-Bürger hätten dem Land in Scharen den Rücken gekehrt. Bauern verloren ein Drittel ihres Einkommens - unter anderem, weil ein Großteil der Brüsseler EU-Subventionen nicht durch London ersetzt wurde.
Um die Regale in Supermärkten und Discountern wieder zu füllen, habe die britische Regierung unter anderem Handelsverträge mit Staaten abgeschlossen, deren Bauern deutlich kostengünstiger als ihre Kollegen im Vereinigten Königreich produzieren.
Die Folge: Marktanteile der britischen Bauern seien rückläufig. Der Chefökonom des britischen Bauernverbands National Farmers Union, Sean Rickard, sagt deshalb: „Die einzige Chance auf Rettung könnte sein, in fünf bis zehn Jahren wieder zurück in den EU-Binnenmarkt zu kommen.“
EU-Bio-Verordnung war Grundlage des Wachstums
Für Rolker ist das Wachstum des Öko-Obstbaus in Deutschland und Europa eng verbunden mit der Europäischen Union. Er verweist auf die europäische Bio-Verordnung von 1991.
Mit dem Regelwerk wurden das Verbot zur Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz - und Düngemitteln sowie das Gentechnik-Verbot festgeschrieben. Die erste Bio-Verordnung sei noch sehr praxisorientiert gewesen, die folgenden von 2007 und 2018 seien bedauerlicherweise Werke von Juristen gewesen, so Rolker.
Die erste Bio-Verordnung legte seinerzeit die ersten Grundlagen und schaffte verbindliche Grundregeln. „So konnte sich der Markt erst entfalten“, sagt Rolker. Der Ladekoper gehörte in den 1990er Jahren zu den ersten Öko-Bauern im Alten Land.
Jeder zweite deutsche Bio-Apfel wird an der Niederelbe produziert
Mittlerweile liegt der Öko-Anteil bei der Produktion an der Niederelbe bei 20 Prozent. Jeder zweite deutsche Bio-Apfel wird hier produziert. EU-weit galten und gelten die gleichen Grundregeln - auch für die Importe. Schon früh sei klar gewesen, dass der Bio-Obstbau in Brüssel und Straßburg nur gehört wird, wenn er möglichst mit einer Stimme spricht. „Gemeinsamkeit macht stärker“, sagt Rolker.
Im Jahr 2000 rückten die Bio-Obstbauern aus fünf EU-Staaten zusammen, im Fokus stand damals die Zusammenarbeit bei Produktion und Vermarktung im Zuge der Einführung der schorfresistenten Apfelsorte Topaz.
Fünf Länder machen gemeinsame Sache
Vor allem Obstbauern aus Deutschland, Italien (Südtirol), Österreich, den Niederlanden und Belgien machten gemeinsame Sache.
Im Juni 2006 gründeten sie das Europäische Bioobst-Forum, Rolker wurde Vizepräsident. Mittlerweile gehören 20 Erzeugergemeinschaften aus sieben europäischen Ländern mit 1000 Einzelbetrieben dazu.
Auch in Frankreich ist das Europäische Bioobst-Forum aktiv. Rolker: „Unser Stimme wird gehört, in der Kommission, in der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und im Agrarausschuss.“ Bei der Expo 2015 in Mailand war Rolker als einer von 300 Bio-Experten eingeladen worden.
Obstbau-Lobbyist in Brüssel, Bonn und Berlin
Eine Aufgabe des Präsidiums sei immer wichtiger geworden: Einflussnahme auf die nationale und europäische Politik. Industriekonzerne und einige Mitgliedsstaaten versuchten im Zuge der Zulassung von Mitteln immer wieder, ihre (Wirtschafts-)Interessen durchzusetzen - unabhängig von wissenschaftlicher Betrachtung. Rolker verweist auf die Zulassung von Öko-Pflanzenschutzmitteln wie Kupfer.
Kupfer als Wirkstoff für Obstbau gesichert
Doch ähnlich wie die Kollegen im Integrierten Obstanbau mussten und müssen auch die Öko-Obstbauern immer wieder um ihre Mittel kämpfen. Ein Beispiel: Das Bioobst-Forum habe einen wichtigen Beitrag geleistet, damit Kupfer weiterverwendet werden darf. Nach viel Überzeugungsarbeit wurde Kupfer als Pflanzenschutzmittelwirkstoff gesichert.
Das Metall ist laut Rolker „unverzichtbar“ bei der Bekämpfung von Schorf und Obstbaumkrebs. Doch insbesondere die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) fordert immer wieder den Ersatz, wenn es eine Alternative gibt.
„Ohne Kupfer könnten wir nicht wirtschaftlich arbeiten“, sagt Rolker. In Forschungsprojekten wurde der Beweis angeführt, dass das Metall sich weder in Pflanzen, Früchten, Böden noch in Gewässern anreichert. Aktuell gilt die Zulassung bis zum 31. Dezember 2025.
Allerdings habe die EFSA mit Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse eine Verlängerung um weitere sieben Jahre in Aussicht gestellt. Die Zulassung war verbunden mit einer Minimierungsstrategie auf drei Kilogramm pro Hektar. „Auch diese war Teil des Durchbruchs“, sagt Rolker.
Wo Rolker noch Reformbedarf bei der EU sieht
Der Altländer sieht allerdings noch viel Reformbedarf bei der EU, notwendig seien ein Abbau von Bürokratie und mehr Praxisorientierung. So setzen Bio-Obstbauern unter anderem Brennnessel- oder Quassia-Extrakte (Bitterstoff aus dem tropischen Quassia-Bäumchen) ein. Das sind Naturstoffe, die im Gegensatz zu chemisch-synthetischen Mitteln nicht zu 100 Prozent reproduzierbar sind.
Inhaltsstoffe schwanken in der Natur. Das ist für Brüssel das Problem. Doch mit Quassia lasse sich die Apfelsägewespe wirksam bekämpfen. Trotzdem gibt es keinen EU-Stempel, sondern nur eine nationale Ausnahmeregelung.
Paradox: In Cola oder Energy Drinks ist Quassia kein Problem für Brüssel. Hier sieht Rolker Reformbedarf. Er fordert eine Dauergenehmigung. Dass die EU-Kommission mit der Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use Regulation) erst einmal gescheitert ist, findet Rolker gut. Eine Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent hätte auch den Öko-Obstbau existenziell getroffen.