T Rock-Urgestein Achim Reichel: „Ich muss jetzt mal den Schädel sauber kriegen“
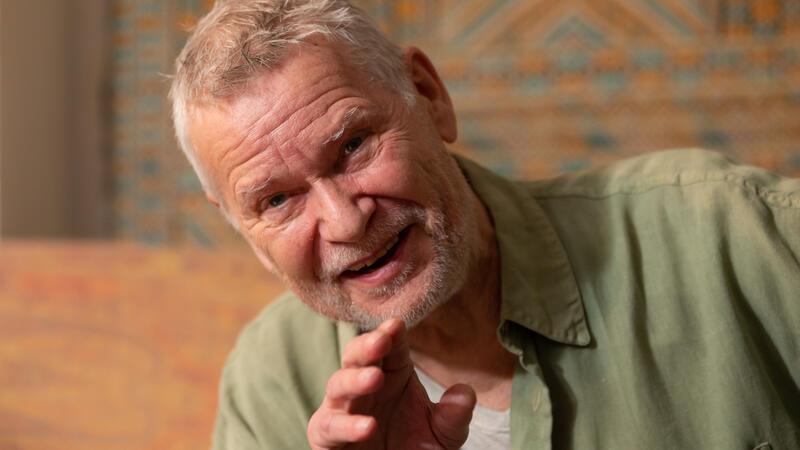
Achim Reichel gilt als Urvater der deutschen Rockmusik. Foto: dpa Foto: picture alliance/dpa
Das Telefon steht nicht still. Auch nicht während des Gesprächs, zu dem der Musiker Achim Reichel in seinem Studio am oberen Alsterlauf TAGEBLATT-Mitarbeiter Manfred Ertel empfängt. Die wohl längste deutsche Rock-Karriere es gibt viel zu erzählen.
Hamburg. TAGEBLATT: Haben Sie eigentlich manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn Sie an die Zeit nach Ihren Abschiedskonzerten im Frühjahr denken und im wahrsten Wortsinn nur noch Alt-Rocker sind?
Achim Reichel: Vielleicht, obwohl ich mich glücklicherweise noch gar nicht altersentsprechend fühle. Aber ich finde, ich muss jetzt mal den Schädel sauber kriegen. Ich will nicht mehr nur irgendwelche Verpflichtungen erfüllen, ob das nun die nächste Platte ist oder die nächste Tournee. Deshalb dachte ich: Alter, mach‘ einen Strich und hör‘ mal in dich rein. Es gibt so viele Sachen, die vielleicht interessanter sind als in altbekannter Routine wieder mal ein Album zu machen, nur weil man noch ein paar musikalische Ideen hat. Nachdem ich für meine Autobiografie verdammt viel Komplimente bekommen habe und neulich so eine verrückte Idee hatte, könnte ich mir genauso gut vorstellen, noch mal ein Buch zu schreiben. Nochmal was anderes zu erleben, wäre vielleicht gar nicht schlecht.
Der Titel von Tour und Album ist „Schön war es doch“. Hatten Sie irgendwann mal Zweifel daran?
(lacht) Es war ja nicht nur schön. Das meiste schon, aber nicht nur. Hier und da hatte ich vielleicht mal mehr erwartet, auf der anderen Seite kam dann mehr, wo ich es gar nicht erwartet hatte. Als Rockmusiker so oft die Genres wechseln zu können, sind zum Beispiel Dinge, die heute nicht mehr möglich sind. Da würde man gleich die rote Karte kriegen. Und Tourneen sind schon auch anstrengend. Wenn man vor den Leuten steht, vergisst man das kurz. Aber hinterher merkt man, dass man richtig angezapft worden ist. Unterm Strich habe ich aber überhaupt keinen Grund zu klagen.
Sind Sie der Bundeswehr, die ja verantwortlich für den Bruch in Ihrer Karriere war, manchmal auch ein bisschen dankbar?
Ein wenig schon, das gebe ich ehrlich zu. Das hat das erste Mal meinen Kopf ein bisschen frei gemacht. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich körperlich doch ein ganz fitter Junge war, das ist mir da erst richtig klar geworden. Auf der Bühne als junger Springer merkt man das ja gar nicht so.
Haben Sie der Zeit mit den „Rattles“, mit denen Sie immerhin an der Seite der „Rolling Stones“ und der „Beatles“ auf Tour waren, manchmal ein bisschen nachgetrauert?
Nee, und wenn doch, nur ganz flüchtig. Irgendwann wurde mir schnell klar, dass dieses Beat-Business, wie es damals hieß, in England und noch schlimmer in Amerika relativ schnelllebig war. Wie schnell ging es zum Beispiel, dass etwa die „Searchers“ von gestern waren. Wie schnell ging es bei vielen anderen Beatbands, die irgendwann auf Nostalgie-Festivals auftraten und sonst eigentlich gar nicht mehr von sich reden machten. Die sind in ihrer Zeit mit einem Label beschriftet worden und dabei blieb es.
Hätten Sie mit den „Rattles“ genauso erfolgreich sein können?
Ich glaube, die Dinge, die ich mir in meiner Karriere geleistet habe, hätte ich mit den „Rattles“ nicht machen können. Dafür waren neben mir noch andere starke Egos in der Band unterwegs und wollten ihr Ding machen. Alles für sich allein entscheiden zu können, war für mich ganz gut.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet erst Shantys und später dann Lyrik zu rocken?
Mir wurde klar, dass es im englischsprachigen Ausland so viel gab, was es hier nicht gab, aber geben sollte. Zum Beispiel Folk-Rock. Da gab es in England eine riesen Szene mit hochinteressanten Bands. Das mochte ich. Außerdem produzierte ich damals die Gruppe „Ougenweide“, die mittelalterliche Musik machte. Da war der Schritt zum Shanty nicht mehr so groß. Und wie so oft bei mir bin ich vom Schicksal fast mit der Nase auf die Lieder gestoßen, als ich einfach ein paar Fingerübungen auf der Gitarre machte und plötzlich etwas am Wickel hatte …
… für das es damals aber doch kaum erfolgreiche Beispiele wie heute „Santiano“ gab. Shantys wurden nur in der Schule gesungen. Waren Sie vom Erfolg trotzdem überzeugt?
Überhaupt nicht. Ich war einfach nur begeistert von der Entdeckung, dass Shantys eigentlich eine Art Weltfolklore sind. Es gab die in mehreren Sprachen, die Schiffe fuhren durch alle Länder Häfen. Und es waren ja Arbeitslieder. Damals wurde bei der Arbeit noch gesungen. Das fand ich einfach aufregend. Obwohl wir mit den „Rattles“ und „Wonderland“ schon recht erfolgreich waren, wollte das „Shanty-Album“ anfangs auch keine Plattenfirma veröffentlichen. Alle haben gesagt: Achim, was soll das denn, lass mal lieber. Die es dann am Ende machten, haben es dann überhaupt nicht bereut. Und wie man heute sieht, war es der Zeit vielleicht voraus.
Hat Ihnen das Mut gemacht, sich bald danach auch an Lyrik und Prosa zu trauen?
Bei beiden Shanty-Alben war ja schon der eine oder andere alte Dichter dabei. Und auch ein weniger alter, nämlich Ringelnatz. Die waren mir bis dahin nur in der Schulzeit schon mal über den Weg gelaufen. Als unliebsame Übungen zum Auswendiglernen. Erst Mitte der Siebziger wurde mir langsam klar, welch hohe Qualität diese alten Dichter und Denker an den Start gebracht haben. Das hat mich sehr beeindruckt, beflügelt und inspiriert. Beim Urlaub mit der Familie in Blokhus in Nord-Dänemark marschierte ich dann mit der Gitarre durch die Dünen. Und die Melodien kamen nur so angeflattert.
Die Begeisterung auch?
Ich stand wieder vor der Frage: Mach‘ ich das oder lass‘ ich es lieber. Da bin ich vielleicht ein bisschen Sturkopf gewesen oder ich hatte schon ausreichend Selbstbewusstsein. Aber Begeisterung für die eigene Sache ist für mich immer mehr wert gewesen, als ein paar Pop-Stücke zu machen, Vorschuss zu kassieren, und dann ist erstmal wieder Ruhe.
Wie fanden Ihre Töchter das, wenn die in der Schule gefragt wurden, „Was ist Euer Papa eigentlich von Beruf?“ Konnten Sie mit Ihnen angeben?
Dass ihr Vater ab und zu mal im Fernsehen war, damit konnten sie schon mal angeben. Aber Anfang der Achtziger trafen wir auch mal die Eltern einer Schulfreundin unserer Tochter. Und da sagte die Freundin „Dein Vater ist ja längst weg vom Fenster“. Und ich dachte: Okay, ich bin wohl nicht Everybody‘s Darling. Will ich aber auch nicht. Ich will es gar nicht allen recht machen, denn dabei kann man schnell sein Gesicht verlieren.
Gibt‘s es etwas in Ihrer Karriere, das Sie später bedauert haben?
Es gibt nur eine Situation, wo ich mir untreu geworden bin. Nachdem wir schon einen eigenen Musikverlag hatten und auch ein eigenes Label nur für deutschsprachige Rock-Musik gründen wollten, machte die Plattengesellschaft zur Bedingung, dass unter den ersten Langspielplatten eine von Achim Reichel dabei sein sollte. Ich dachte, kein Ding. Und habe eine LP gemacht, die ich 20 Jahre später vom Markt genommen habe. Die „Heiße Scheibe“, da habe ich die Texte mehr oder weniger im Auto auf dem Weg zum Studio zusammengebastelt, das war leichtfertig.
Frisch bei der Bundeswehr marschierten sie im Video in Uniform über den Exerzierplatz und sangen „Trag es wie ein Mann“. Was war da los?
Naja, das war ja nicht meine Entscheidung. Ich war meiner stolzen blonden Mähne beraubt, plötzlich Soldat und hatte stramm zu stehen und fand mich in einem völlig anderen System als kleine Nummer wieder. Dann kamen die Plattenfirmen und sagten, wenn du jetzt so ein Lied aufnimmst, will dich das ganze Land ans Herz drücken. Ich landete in einem Studio und dachte, ich hör‘ nicht richtig: mit opulentem Geigenplayback, noch nicht mal in meiner Tonart. Da war ich nicht Herr meiner selbst. Aber das Video ist heute natürlich total witzig.
Worauf sind Sie besonders stolz?
Auf meine Vielfältigkeit. Als ich zum Beispiel mit „A.R. + Machines“ zu elektronischen Klängen auf psychedelische Reise ging, haben die Plattenfirmen gesagt: Ganz interessant, aber mach dir keine Hoffnungen, das ist überhaupt nicht radiokompatibel und in Diskotheken passt das auch nicht. Aber mir machte das Spaß und ich hatte zum ersten Mal was am Wickel, das vorher so überhaupt noch keiner gemacht hatte. 40 Jahre später konnte ich damit die Elbphilharmonie ausverkaufen, das ist doch verrückt.
Und dann wurde 2021 auch noch der fast 30 Jahre alte Kult-Song „Aloha heja he“ ein Nummer-eins-Hit in China …
… und man fragt sich dann, Alter, was hast du denn da zusammengebraut? Wie kann das angehen, dass so ein deutschsprachiger Song in China einen Erdrutsch in Gang setzt? Ich habe Massen von Videos im Internet gesehen und konnte das gar nicht glauben. Ich habe im letzten Jahr mehr in China verdient als in Deutschland und dachte, wer beschenkt dich hier eigentlich? Und jetzt prüfe ich mit meiner Konzertagentur Karsten Jahnke ein Tournee-Angebot aus China, ob ich es annehme oder nicht. Dafür musste ich erst mal achtzig werden. Warum ist so etwas nicht 30 Jahre vorher passiert?
Wann werden alte und alternde Rock- oder Pop-Stars eigentlich peinlich?
Gute Frage. Das erlebt ja auch jeder anders. Viele Leute finden es zum Beispiel toll, dass die Rolling Stones grad noch mal ein Album mit neuen Stücken aufgenommen haben. Das Video dazu macht mich aber schon ein bisschen nachdenklich und ich frage mich, haben die sie noch alle? Da sieht man immer noch - sorry - blonde junge Hühner, knapp bekleidet in Sport-Cabriolets. Und ich denke, ach Baby, das ist doch sowas von gestern. Wenn Menschen mit Ende Siebzig sich so präsentieren muss man sich doch fragen, hallo, für wie dumm haltet ihr eigentlich euer Publikum.
Zur Person
Als Feldjäger der Bundeswehr den Frontsänger und Gründer der erfolgreichsten deutschen Beatband „The Rattles“ 1966 von der Bühne der Konzertmuschel in Hamburgs Park „Planten un Blomen“ zerren und in die Kaserne schleppen, ist die Rock-Karriere des damals 22-jährigen blonden Mädchenschwarms jäh am Ende. Nach 30 Singles mit den „Rattles“ ist er nach dem Militärdienst praktisch auf sich allein gestellt. Und nimmt das wörtlich. Nach einigen erfolgreichen Titeln mit „Wonderland“ startet er schnell eine Solo-Karriere, in der er gleich mehrfach die Genres wechselt. 1971 geht er mit psychedelischen Trance-Klängen auf „Grüne Reise“, die vier Alben währt. 1976 traut sich der aus einer Seefahrerfamilie stammende Musiker zum ersten Mal an Shantys und Seemannslieder. Ab 1978 rockt er zunächst zu guter alter deutscher Lyrik von Goethe, Fontane oder Liliencron, später folgen junge deutsche Dichter wie Kiev Stingl, Peter Paul Zahl und vor allem Jörg Fauser, der bis zu seinem frühen Unfalltod ein enger Freund ist.
Sein größter Hit ist wohl „Aloha heja he“ 1991: Der von Kritikern „Mitgröl-Shanty“ genannte Kultsong bringt ihm die goldene Schallplatte ein und katapultiert den deutschen Alt-Rocker 2021 sogar in China auf Platz eins. Nach über 30 Alben soll jetzt Schluss sein.
Am 28. Januar ist der Urvater des deutschen Rock 80 Jahre alt. Zur Feier erscheint sein Album „Schön war es doch – das Abschiedskonzert“, das er dann ab 9. März in Kiel auch auf der Bühne startet. In 15 Städten sagt der Hamburger persönlich „Tschüss“, unter anderem am 14. März in der Elbphilharmonie und am 26. März in Osnabrück.
Bitte ergänzen Sie ...
Stones oder Beatles?
Die Beatles haben eine einfach eine größere kompositorische Vielfalt an den Start gebracht.
Alster oder Elbe?
Schon die Elbe: Da geht‘s in die Welt hinaus und von der Alster geht‘s einfach nur in die Elbe.
Labskaus oder Fischbrötchen?
Labskaus kenne ich noch aus meiner Jugend als meine Mutter immer mit so merkwürdigen Dosen aus Argentinien ankam. Ich habe Labskaus immer sehr gern gemocht.
Star Club oder Top Ten?
Star Club, weil der unterm Strich die interessanteren Künstler gebracht hat.
Wacken Open Air oder Reeperbahn Festival?
Schön, dass es sie gibt. Das Reeperbahn Festival mehr so als Business-Fest und Wacken tatsächlich als eine Art Kirchentag für Heavy Metal.
Elbphilharmonie oder Große Freiheit 36?
Das ist eine gemeine Frage: Die Elphi ist ein Kulturtempel, die Große Freiheit ist ein bisschen schmutziger und hat eine andere Authentizität. Ich spiele gern in beiden.







