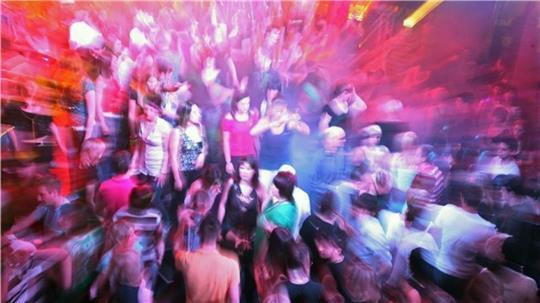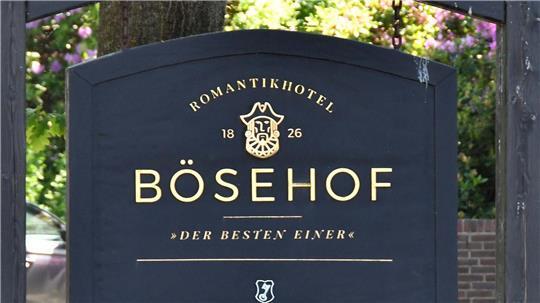TBeinamputation: Chirurg wird selbst zum Patienten

Dr. med. Wolf-Dieter Seifert träumt davon, eines Tages wieder am Deich entlangzuspazieren. Foto: Arnd Hartmann
Dr. Wolf-Dieter Seifert hat als Chirurg unzählige Oberschenkel amputiert und ist mit dem Ablauf bestens vertraut. Aber als der erfahrene Chirurg selbst zum Patienten wird, schaltet sein Verstand auf Autopilot.
„Im Nachhinein habe ich überlegt: Was hast du dir dabei gedacht? Du musst das doch gemerkt haben? Wo ist denn die ganze Erfahrung geblieben?“, fragt sich Seifert heute. Ein Vierteljahr ist vergangen, seitdem sein linkes Bein amputiert worden ist. Sein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Früher ist der Rentner leidenschaftlich gerne Fahrrad gefahren oder genoss lange Deichspaziergänge. Heute träumt er davon, diese Aktivitäten in der Zukunft wieder machen zu können.
Kampf gegen den Gefäßverschluss
Bei Seifert wurde ein akuter Gefäßverschluss im linken Bein festgestellt. „Die versorgende Arterie war auf der Höhe des Kniegelenks verstopft und nach unten zum Fuß gab es keinen Anschluss. Kein Sauerstoff oder Blut konnte transportiert werden“. Normalerweise würden die Ärzte in diesen Fall einen Bypass legen, um das Bein zu retten. „Man setzt gewissermaßen ein verlängertes Rohr an den verstopften Ort dran, sodass zwei Stellen, die verschlossen sind, wieder miteinander verbunden werden. Dadurch wird das Bein erneut ordentlich durchblutet“, erklärt Nele Mielke, Kommunikationsverantwortliche des Ameos Klinkums.
Um diese Umleitung zu schaffen, nutzen die Ärzte in den meisten Fällen eigene Venen. Für Seifert war diese Möglichkeit ausgeschlossen. Aufgrund seiner Gefäßkrankheit wurde ihm bereits bei einem vorherigen chirurgischen Eingriff die brauchbare Vene entnommen. „Somit war das Todesurteil über das Bein gesprochen“, berichtet Seifert trocken.
Der unerwartete Autopilotmodus
Eigentlich hätte er, das ist ein Vorwurf an sich selbst, die klaren Zeichen nicht übersehen dürfen. Schließlich hat der Chirurg viele Patienten beraten und ist mit den Symptomen vertraut. Als er plötzlich selbst zum Patienten wird, schaltet sein Verstand ab. „Aber wenn man selbst Chirurg ist, dann möchte man nicht wahrhaben, was da passiert“, sagt Seifert und klingt bedrückt.
Ganz allmählich stirbt sein Bein. Die Zehen gammeln ab, seine Haut nimmt an den betroffenen Stellen eine bläuliche Färbung an und ein intensiver Schmerz wird zu einem ständigen Gefährten. Seifert sagt, dass der Schmerz als Sauerstoffmangelschmerz bezeichnet wird. Er tritt auf, wenn der Unterschenkel keinen Sauerstoff und kein Blut mehr bekommt. Seifert erinnert sich an den Schmerz: „Das war schon heftig. Da kommen sie an einen Punkt, wo man sagt: Schneid das Bein ab.“
Seine Reise nach der Amputation
Eine Woche blieb Seifert nach der Amputation im Krankenhaus. Die gewohnte Beweglichkeit war weg. Kein Segeln, kein Auto fahren mehr. Seifert geht einen Moment in sich und erzählt: „Man schaut an sich herunter und denkt: Sieht nicht aus, wie früher, ist schlecht. Es war eine miese Situation.“ Seine Familie fängt ihn nach der Amputation auf. Aber viel gesprochen wird über die aktuelle Situation nicht. Jedes Familienmitglied setzt sich allein mit der Amputation auseinander. Für Seifert kam eine psychologische Betreuung nicht infrage. „So etwas ist nichts für mich“, erzählt er.
Nach der Abheilung seines Stumpfes beginnt der ehemalige Chirurg sofort mit der Physio- und Ergotherapie im Ameos Klinikum. Zweimal die Woche fährt ihn seine Frau zu den Terminen. Seifert sagt: „Ein Lob an den Chirurgen, der das Bein abgenommen hat. Der Stumpf hat sich nicht entzündet und die Prothese sitzt passgenau auf.“
Während seiner Behandlung hat er anfänglich immer wieder mit Phantomschmerzen zu kämpfen, die an der Stelle des amputierten Körperteils auftreten. Seifert vergleicht diesen Schmerz mit einem Blitz. Er tritt plötzlich und ohne Vorwarnung auf. Medikamente und die beständige Therapie wirken dem Phantomschmerz entgegen. Heute ist er kaum noch spürbar.
Von Anfang an ist Seifert in der Physiotherapie sehr willensstark und diszipliniert. Seine behandelnde Physiotherapeutin Alexandra Lapp lobt seine eindrucksvollen Fortschritte. Er muss sich nicht mehr mit dem Rollstuhl fortbewegen, sondern ist derzeit mit einem Rollator mobil. Lapp betont, dass die Fortschritte während der Behandlung sehr individuell sind. Je nachdem, wie weit der Patient ist, wird die Behandlung entsprechend angepasst.
Zwischen Fremdkörpergefühl und Akzeptanz
„Man hat ein enormes Fremdkörpergefühl und denkt, die Prothese gehört einfach nicht zu mir“, erzählt Seifert. Ein Rollstuhl wäre der bequemere, einfachere Weg, aber für ihn ausgeschlossen. Rückschläge zehren immer wieder an seinen Nerven. „Freunde sind die Prothese und ich nicht, aber ich kann sie akzeptieren.“
Für Seifert steht fest: Der Heilungsprozess braucht Zeit und ist nicht einfach. „Es geht wie im Leben auf und ab. Man muss eine Entscheidung treffen: Will ich mein Leben lang im Rollstuhl sitzen bleiben oder will ich wieder versuchen zu laufen?“ Wolf-Dieter-Seifert hat seine Entscheidung getroffen - und sich für das Laufen entschieden.