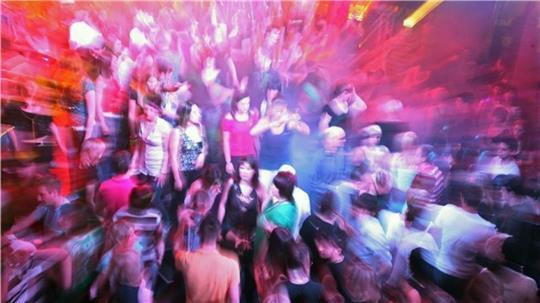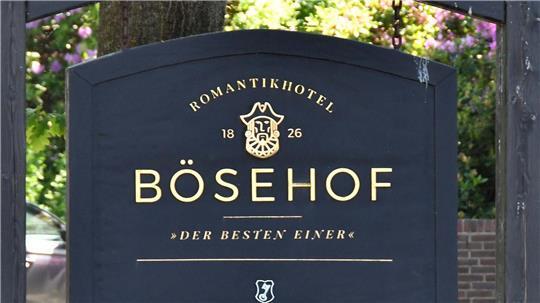TInobhutnahme: Wenn Kinder aus ihrem Zuhause fliehen müssen

Wenn Kindern und Jugendlichen zu Hause Gewalt und Vernachlässigung droht, werden sie in akuten Notsituationen in einer Inobhutnahmestelle untergebracht, um sie zu schützen. Foto: Patrick Pleul
Wenn das eigene Zuhause für Jugendliche zu gefährlich ist und sie dort nicht bleiben können, bietet eine Inobhutnahmestelle schnellen Schutz. Eine Mitarbeiterin einer solchen Unterkunft erzählt von ihrem Alltag.
Zeven. Was für viele Kinder und Jugendliche unvorstellbar ist, ist für andere Realität: Das Zuhause bietet keinen Schutz, es droht Gefahr und Missbrauch oder es fehlt an lebenswichtiger Zuwendung. Dann bleibt oft nur die Möglichkeit, das Zuhause zu verlassen. Aber wohin kommen die Kinder und Jugendlichen, die zu ihrem eigenen Schutz fliehen müssen?
Die Inobhutnahmestelle ist ein Schutzraum und muss es bleiben
Für solche Fälle gibt es besondere Einrichtungen, sogenannte Inobhutnahmestellen. Wann ein Kind in Obhut genommen wird, ist im Sozialgesetzbuch VIII geregelt und wird vom Jugendamt oder einer anderen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung entschieden. Kurz erklärt ist die Inobhutnahme eine vorläufige und kurzfristige Unterbringung eines Schutzbefohlenen, der sich in einer akuten Notsituation befindet. Es geht dabei um eine schnelle und unbürokratische Lösung, um den Minderjährigen zu schützen.
Da es sich bei einer Inobhutnahmestelle um einen sensiblen Schutzraum für Kinder und Jugendliche handelt, wird keine Adresse oder Telefonnummer der Unterkunft herausgegeben. Um diesen Schutz nicht zu gefährden, wird in diesem Bericht nicht auf den genauen Standort der Inobhutnahmestelle eingegangen. Auch der Name der Mitarbeiterin wurde verändert.
Jana arbeitet seit circa einem Jahr in einer Inobhutnahmestelle in Niedersachsen. In diesem Haus werden Kinder zwischen 11f und 17 Jahren aufgenommen. Es können maximal neun Kinder untergebracht werden. Manche bleiben nur ein paar Tage, andere für ein paar Wochen. Der Sinn dieser Einrichtung ist es, die Zeit zu überbrücken, in der eine geeignete Langzeitunterbringung für die Schutzbedürftigen organisiert wird. „Wir werden in der Regel von der Polizei benachrichtigt, wenn Schutzbedarf festgestellt wurde und die Kinder in Obhut genommen werden müssen. Dann fahren wir los und holen sie bei der Polizei oder aus dem Krankenhaus ab, auch mitten in der Nacht“, sagt Jana.
Missbrauch, Verwahrlosung und Gewalt als Gründe für Inobhutnahme
„Die Kinder und Jugendlichen, die bei uns ankommen, leiden oft unter Verwahrlosung. Ihre Eltern kümmern sich nicht einmal um ihre Grundbedürfnisse. Sie bekommen nicht genug Essen und Schlaf“, so Jana weiter. Die Gründe dafür, dass ein Kind aus seiner gewohnten Umgebung geholt wird, sind vielfältig. Pubertäre Ausbrüche der Jugendlichen, mit denen die Eltern überfordert sind, Konflikte im Elternhaus und häusliche Gewalt machen die meisten Inobhutnahmen nötig.
Eine Inobhutnahme hat bei Jana einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ein Mädchen war von Ehrenmord bedroht und musste dringend in Sicherheit gebracht werden. Sie wurde von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Als das Mädchen ihrer Mutter davon erzählte, wurde sie von ihrer Mutter verprügelt. Die Mutter gab ihrer Tochter selbst die Schuld an dem Übergriff.“ Das Mädchen wurde vorübergehend von Janas Team betreut, dann in eine Einrichtung nach Süddeutschland gebracht. Jana ist sich sicher, dass sie dort eine neue Identität bekommen hat.
Jugendliche lernen in der Einrichtung einen strukturierten Alltag kennen
Den Kindern fehlt es aber nicht nur an Schutz, Essen und Schlaf. Zu Hause haben sie oft keine Strukturen kennengelernt. „Bei uns gibt es feste Regeln und Tagesabläufe. Es gibt feste Mahlzeiten und die Kinder müssen sich an der Arbeit im Haushalt und im Garten beteiligen. Nachts wird geschlafen. So werden die Kinder mit einem geregelten Alltag und Grenzen vertraut gemacht“, sagt Jana.
Die Jugendlichen blühen oft auf, wenn sie merken, dass sie in der Einrichtung ernst- und wahrgenommen werden, erzählt Jana. Am besten gefällt es ihr, wenn gemeinsam gegessen wird. „Bei den Mahlzeiten entstehen die tollsten Gespräche mit den Kindern. Oft sitzen wir noch lange zusammen, obwohl schon niemand mehr isst, einfach nur zum Reden.“ Auch wenn es Streit gibt, ist es für die Mitarbeiterin wichtig, die Kinder auf ihr problematisches Verhalten hinzuweisen. Danach werden die Jugendlichen aber wieder wertschätzend behandelt und respektiert.
Handys und soziale Medien beeinflussen die Kinder negativ
In der Einrichtung herrscht aus Sicherheitsgründen für die Jugendlichen ein strenges Handyverbot. Die Mobiltelefone könnten geortet werden oder die Kinder geben selbst ihren Aufenthaltsort preis. „Wenn die Kids ihre Mobiltelefone abgeben sollen, ist es so, als würde man ihnen den Arm abhacken. Heute laufen alle sozialen Kontakte hauptsächlich über das Handy“, sagt Jana.
Die sozialen Medien, vor allem Tiktok, hält Jana für eine Gefahr für die jungen Menschen. Nicht selten erzählen ihr 14-jährige Mädchen, dass sie sich die Brüste vergrößern oder die Lippen aufspritzen lassen wollen. „Gerade die Mädchen eifern einem Schönheitsideal nach. Sie bewundern die Frauen, die sie im Internet sehen, für ihr Aussehen, wissen aber nicht, dass es sich um gefakte Bilder handelt. Das verzerrt ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit total und sorgt dafür, dass die Kinder mit sich selbst unzufrieden sind“, so Jana weiter.
Mitarbeiter sollen Distanz wahren, was aber manchmal schwerfällt
Jana freut sich darüber, dass sie den Kindern während ihrer Unterbringung eine gute Zeit mit einem Gefühl von Sicherheit ermöglichen kann. Trotzdem ist es wichtig, dass sie die Distanz gegenüber den Schutzbefohlenen bewahrt. „Wir Mitarbeiter machen keine Bindungsarbeit mit den Kindern, da sie nicht bei uns bleiben sollen und die Trennung dann nicht schwerfallen darf. Aber natürlich baut man eine Beziehung zu den Kindern auf, wenn sie über ein paar Wochen bleiben und man etwas mit ihnen unternimmt. Am wichtigsten ist mir immer, dass die Kinder bei uns lernen, dass nicht alle Erwachsenen scheiße sind“, sagt Jana.
Viele Erlebnisse beschäftigen Jana auch zu Hause. Besonders berührt hat sie ein 14-jähriges Mädchen, das stark von Suizid gefährdet war. „Sie ist immer wieder abgehauen und hat sich selbst und andere in Gefahr gebracht. Das Schlimme war für mich, dass man ihr nicht helfen konnte. Sie hat uns Mitarbeitern alles abverlangt. Wir haben alle nicht mehr geschlafen und waren ständig in Alarmbereitschaft.“
Um mit diesem belastenden Arbeitsalltag umgehen zu können, nehmen Jana und ihre Kollegen regelmäßig an Supervisionen teil. Auch innerhalb des Teams wird gut aufeinander geachtet. „Wir weisen uns gegenseitig darauf hin, wenn wir uns zu viel um ein Kind kümmern. Wir müssen nicht nur uns selbst, sondern auch das Kind schützen. Und es soll auch nicht der Eindruck unter den Jugendlichen entstehen, dass einer bevorzugt wird“, sagt Jana. Sie vermutet, dass sie ohne diesen guten Rückhalt und die gegenseitige Unterstützung durch die Kollegen mit den schweren Schicksalen der Jugendlichen, die ihr jeden Tag begegnen, nicht so gut klarkäme.