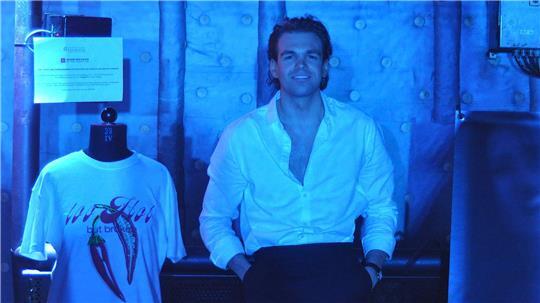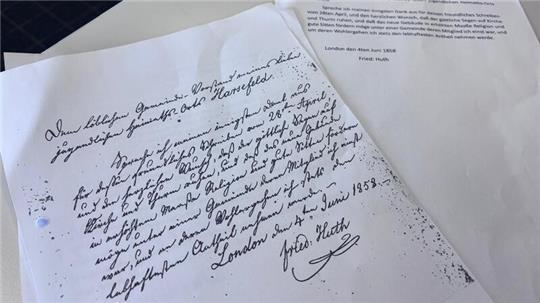TKritik an moderner Jagd: Machen Technik und Crashkurse das Handwerk kaputt?

Jens Hariefeld sieht in der modernen Jagd auch viele Chancen. Foto: Ahrens
Immer mehr Menschen wollen Jäger werden - und die Jagd wird immer moderner. Nicht alle sehen diesen Entwicklungen positiv entgegen. Crashkurse und neue Technik bieten Angriffspunkte für Kritik. Doch der Fortschritt des Jagdwesens hat viele Vorteile.
Harsefeld. „Ist das noch meine Jagd?“ Diese Frage stellt sich Klaus Dammann-Tamke aus Ohrensen. Einige Entwicklungen bereiten dem 68-Jährigen Sorge. „Wir laufen Gefahr, dass das jagdliche Handwerk dabei auf der Strecke bleibt“, so der Jäger und ehemalige Tierarzt. Nachhaltigkeit der Jagd beinhalte auch eine aktive Lebensraumgestaltung, wie Hecken anpflanzen, Wildäcker einsäen, Wegränder gestalten.
Der Statistik vom Deutschen Jagdverband zufolge investierten Jäger 2022/23 durchschnittlich 41 Stunden Arbeit pro Monat in ihr Revier, 16 davon für die Revierpflege. Dass sich bei den Pflichtaufgaben eines Reviers nicht alle Jäger gleichermaßen an vorderster Front beteiligen, sei auch schon in seiner Generation so gewesen, sagt Jens Hariefeld, stellvertretender Vorsitzender der Kreisjägerschaft Stade. Das gebe es auch in jedem Verein. Den Trend von immer weniger Hege des Reviers kann er aber nicht bestätigen. Der Kutenholzer wohnt in einem Haushalt voller Jäger: Sowohl seine Frau als auch seine drei Kinder besitzen einen Jagdschein.
So viele Jäger wie nie zuvor
Über 400.000 Jäger gibt es laut Deutschem Jagdverband bundesweit. Klaus Dammann-Tamke, Bruder des Ex-Landtagsabgeordneten und Präsidenten des Deutschen Jagdverbands Helmut Dammann-Tamke, spricht von einem Jägerboom. Und es stimmt: Im Jahr 2022 traten 23 Prozent mehr Menschen zur Prüfung an als 2021, in Niedersachsen waren es mit knapp 6000 Prüfungen die meisten. „Bei einer immer kleiner werdenden Jagdfläche: Wo sollen sich all die Jungjäger entfalten und die nötige Erfahrung und Praxis sammeln?“ Der Nachwuchs von Familie Hariefeld kennt die Sorgen. „Einige aus meinem Kurs haben am Anfang nicht direkt eine Jagdmöglichkeit bekommen“, sagt Anna-Sophie (22). Nicht alle Anwärter würden, wie die Hariefelds, in eine Jägerfamilie hineingeboren. Die Kreisjägerschaft hat darum die „Jägertreffs“ eingeführt, um revierlose Jäger mit Revierinhabern zusammenzubringen.

Der ehemalige Tierarzt Klaus Dammann-Tamke ist auf einem Bauernhof in Ohrensen aufgewachsen und geht in seinem Heimatort seit 52 Jahren auf die Jagd. Foto: Jakob Brandt
Jens Hariefeld begrüßt die steigenden Zahlen. Schließlich hätten die Jäger vor gut 15 Jahren noch mit einem negativen Trend gekämpft. Was ihn besonders freut: „Die Männerdomäne ist durchbrochen.“ Frauen hätten maßgeblich zur Trendwende beigetragen. „Bei mir waren mindestens die Hälfte der Teilnehmer im Kurs weiblich“, sagt Tochter Lene Henrike (18).
Jagdschein als Mittel zur Waffe?
Klaus Dammann-Tamke glaubt aber nicht, dass alle Inhaber des „Grünen Abiturs“ wirklich jagen wollen und unterscheidet zwischen Jagdscheininhabern und Jägern. Er vermutet, dass einige die Jagdprüfung nur ablegen, um sich legal eine Waffe kaufen zu können. Versierte jagdliche Lehrmeister seien auch heute noch für Jungjäger unerlässlich, meint Klaus Dammann-Tamke. Doch die Realität sehe oft anders aus, klagt er.
Jens Hariefelds Frau Ria (48) merkt an: „Man bekommt nicht den Jagdschein und geht dann einfach mit der Waffe los.“ Jäger dürfen nicht einfach jagen, wo sie möchten. Wer ein Revier pachten will, muss mindestens drei sogenannte „Jahresjagdscheine“ gelöst haben. Wer schon mit 16 seinen Jagdschein macht, darf bis zur Volljährigkeit nicht alleine losziehen. Die Hariefelds haben bei der aktuellen Jagdmotivation einen anderen Ursprung ausgemacht: Viele Neu-Jäger wollen aus Gründen der Nachhaltigkeit zu einem wertvollen Lebensmittel beitragen - Hege und Pflege inklusive.

In der Jagd wird die Technik immer moderner. Foto: Philipp Schulze/dpa
Private Jagdschulen bieten oft zwei- oder dreiwöchige Kompaktkurse zur Erlangung des Jagdscheins an. Klaus Dammann-Tamke bezweifelt, dass die Jungjäger in der kurzen Zeit eine solide Grundausbildung erhalten. „Wir haben Glück, dass wir unsere Eltern haben“, sagt Till-Henrik Hariefeld (20). Erfahrene Lehrmeister seien wichtig, stimmt er zu. „Aber das Interesse hat man oder nicht, die Erfahrung kommt erst später.“ Dabei sei es meist egal, welche Art von Kurs absolviert wurde. Die Prüfung ist dieselbe. Jens Hariefeld ergänzt: Die Kompaktkurse gäben Leuten die Chance, die beispielsweise durch Schichtarbeit nicht über acht Monate den traditionellen Jagdkurs besuchen können. Diese seien ohnehin immer ausgebucht. „Die Kurse sind nur der Nachfrage nachgekommen.“
Moderne Technik bietet Chancen und Gefahren
Ein weiterer Kritikpunkt von Klaus Dammann-Tamke: Mit moderner Wärmebild- und Infrarot-Technik lasse es sich heute viel einfacher jagen, selbst in tiefster Nacht. In Niedersachsen ist es seit kurzem erlaubt, damit Wildschweine und Räuber wie Fuchs, Marder, Dachs und Nutria zu jagen. Einige Jäger erlegen damit aber auch Reh- und Damwild, ist Dammann-Tamke überzeugt. Hariefeld ergänzt aber: Das Verbot ist bekannt, und schwarze Schafe seien selten und verpönt. „Wärmebild ist ein handgeführtes Gerät und darf nicht auf der Waffe geführt werden.“ Gerade bei der Kitzrettung sei die Technologie nicht mehr wegzudenken. Moderne Technik böte den Jägern heute außerdem den Vorteil, schon auf weite Entfernungen ihr Revier zu beobachten. „Wir müssen nicht mehr überall hinlaufen und alles durcheinander bringen.“
„Ich lehne diese Technik nicht grundsätzlich ab“, sagt auch Klaus Dammann-Tamke. „Es sollte sich aber jeder fragen, ob er diese Technik in seinem Revier wirklich braucht.“ Bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, bei der es darum gehe, die Zahl der Schwarzkittel schnell und nachhaltig zu reduzieren, habe die Technik ihre Berechtigung.