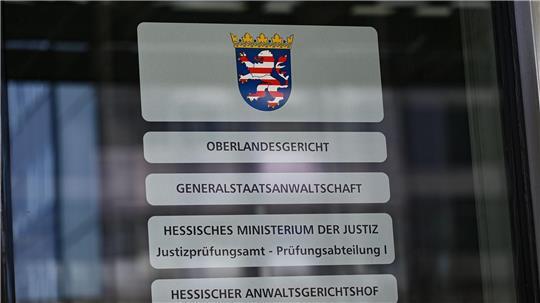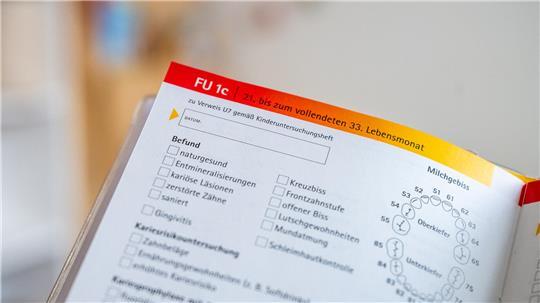TNach Krebserkrankung: Dr. Dohse baut Brüste wieder auf

Dr. Nils-Kristian Dohse arbeitet seit 15 Jahren am Rotenburger Klinikum und betreut als plastischer Chirurg unter anderem Frauen, die nach einer Brustkrebserkrankung für eine Rekonstruktion der Brust infrage kommen. Foto: Hahn
Eine von acht Frauen läuft Risiko, im Leben an Brustkrebs zu erkranken. Nach überstandener Krebserkrankung kommt häufig eine operative Rekonstruktion infrage, ein plastischer Chirurg aus Rotenburg erläutert die Möglichkeiten.
Rotenburg. Seit 15 Jahren arbeitet der Mediziner Dr. Nils-Kristian Dohse am Rotenburger Diakonieklinikum als plastischer Chirurg und führt bei seinen Patientinnen Rekonstruktionsoperationen nach Brustkrebs durch.
Seine Abteilung steht als Kooperationspartner im Rahmen des zertifizierten Brustzentrums im engen Austausch mit der Gynäkologie unter der Leitung von Frau Dr. Karen Wimmer-Freys und der Onkologie und wird immer dann aktiv, wenn ein Tumor nicht brusterhaltend operiert werden konnte.
Volumen- und Konturverlust nach Brustdrüsen-OP ist bedeutsam
„Kleine und früh erkannte Tumoren können meist entfernt werden, ohne dass die betroffene Brust später davon eine Deformität zurückbehält. Bei größeren Befunden wird durch die Kolleginnen und Kollegen der Frauenklinik im Rahmen der Tumorentfernung den Patientinnen auch die Haut erhaltende oder Brustwarzen erhaltende Drüsenentfernung mit zeitgleicher Platzhaltereinlage angeboten.
Weltkinderkrebstag
T Nähende Trostspender: Durch sie bekommt der Krebs ein Gesicht
Dabei wird ein vorübergehender Platzhalter (ein mit Kochsalz gefülltes Silikonimplantat) während der Operation anstelle der Drüse eingelegt, sodass die Patientin nach der Operation auch wieder mit einer intakten Brust aufwacht. Nach erfolgter Heilung und abgeschlossener Krebsbehandlung wird die Wiederherstellung der Brust, sowohl mit endgültigem Brustimplantat als auch mit Eigengewebe durch uns vorgenommen“, sagt der Chefarzt.
Manchmal entspricht die Form und Größe der operierten Brust nicht mehr der der Gegenseite. „Patientinnen haben Anspruch auf Rekonstruktion. Das beinhaltet im Zweifelsfall auch die angleichende Operation der primär unoperierten zweiten Brust“, erklärt Dr. Dohse.
„Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ist seit einigen Jahren im Sinne unserer Brustkrebspatientinnen glücklicherweise sichergestellt. Hier wird ‚im Sinne der Wiederherstellung der körperlichen Integrität nach onkologischer Behandlung‘ gehandelt.“
Zum Wiederaufbau der Brust kommen zwei Verfahren zum Einsatz
Die Patientin kann unter bestimmten Voraussetzungen zwischen Implantat und Rekonstruktion mit Eigengewebe wählen. „Implantate sind eine schnelle Lösung, bergen aber verschiedene Risiken“, erklärt der Mediziner. Wenn die Brust zum Beispiel nach der Tumorresektion bestrahlt wurde, wird eher von einem Implantat abgeraten.
„Durch die Entfernung der Brustdrüse und evtl. notwendige Bestrahlung kann die Durchblutung der Brusthaut stark beeinträchtigt werden. Das kann zum einem zu Problemen bei der Wundheilung führen, denn die Haut muss für ein Implantat ausreichend dehnbar sein. Zum anderen kann sich die Brust mit einem Implantat kühl anfühlen“, erklärt Dr. Dohse. Eine Rekonstruktion mit Implantaten sei aufgrund der notwendigen Dehnung der Haut zudem meistens nur bis zu einem B-Cup möglich.
Rekonstruktion mit Eigengewebe hat viele Vorteile
Wird Eigengewebe zur Modellierung verwendet, beispielsweise vom Bauch, Oberschenkel oder vom Gesäß, besitzt dieses Blutgefäße, die im Bereich der Brust unter Mikroskopsicht angeschlossen werden können. „So haben wir die Möglichkeit, eine Brust jeder Form und Größe zu rekonstruieren, die sich auch wie eine normale Brust anfühlt, denn das Eigengewebe ist ein dauerhafter Brustdrüsenersatz, wächst ein, weicht kleine entstandene Narben wieder auf.

Diese Patientin hat sich das Narbengewebe nach der Rekonstruktionsoperation mit einem geschmackvollen Tattoo übersechen lassen. Foto: Klinikum Rotenburg
Wundheilungsstörungen werden dadurch reduziert. Eigengewebe ist genauso warm wie der Rest des Körpers und ist ebenfalls in der Lage, im Laufe der Jahre auftretende Alterungsprozesse der Gegenseite ebenfalls mitzugehen. Somit haben wir eine sehr natürliche Lösung“, führt der Chirurg aus.
„Habe kurz an Tod gedacht“
T Schock-Diagnose Brustkrebs: Wie Staderin anderen hilft
Manchmal wird das Gewebe auch vom Bauch oder Rücken in die Brust verlagert, ohne das versorgende Blutgefäß zu trennen, dann spricht man von einem „gestielten Gewebetransfer“, einer älteren Technik. Dr. Dohse geht ins Detail: „Wir präparieren den Hautlappen, ohne das versorgende Blutgefäß zu trennen, ziehen ihn vorsichtig an die Stelle der Brust und vernähen ihn dort.
Bei dem sogenannten freien Gewebetransfer vom Oberschenkel oder Gesäß werden auch die Blutgefäße durchtrennt und entsprechend an der Brust eingenäht.“ Durch die Entnahme des Eigengewebes komme es gleichzeitig auch zu einer Straffung der Entnahmeregion. Insgesamt ist die Rekonstruktion mit Eigengewebe etwas aufwendiger als Implantat- oder gestielte Transferverfahren und eine Operation dauert rund vier bis sechs Stunden.
Die spannendste Frage Betroffener: Was passiert mit der Brustwarze?
Die Komplettentfernung vom Brustgewebe samt Brustwarze ist eher selten notwendig. „Dies ist nur bei ausgedehnten Befunden und bei einigen Rezidiven der Fall“, formuliert es der Arzt und geht ins Detail: „Wenn der Primärtumor außerhalb einer Zone von zwei Zentimetern im Abstand zur Brustwarze gewesen ist, kann diese erhalten bleiben.“ Musste die Brustwarze entfernt werden, modelliert der Operateur heute aus Eigengewebe eine Warze. Komplettiert wird die Brustwarzenrekonstruktion zumeist mit einer zusätzlichen Tätowierung.
Die Kunst des Tätowierens in richtigem Farbton ist dabei nicht die einzige Schwierigkeit: „Die Angleichung der Gegenseite in Form und Größe ist manchmal eine ziemliche Herausforderung, wenn zum Beispiel eine zusätzliche Straffung notwendig wird.“ beschreibt Dohse.