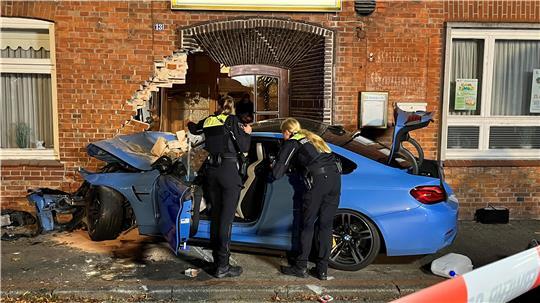TSensationsfund: Geheimnisvolle Kultdolche der Bronzezeit in Kutenholz entdeckt

Rituelle Gaben an übermenschliche Wesen: Bei der Ausgrabung entdeckten die Archäologen in Kutenholz unter anderem diese Klinge eines extrem seltenen, rund 4000 Jahre alten Bronzedolchs (Kurzschwert). Foto: Vasel
Der Sondengänger Frank Hoferichter und der Archäologe Tobias Mörtz schreiben Geschichte. Sie graben sich in die Bronzezeit und vereinen die beiden Kultdolche von Kutenholz.
Kutenholz. Vor 4000 Jahren machen sich die Menschen auf den Weg. Feuer illuminieren die Nacht und die Grabhügel der Ahnen. Alle haben ein Ziel: den Heiligen Berg. Alle wollen am großen Ritual teilhaben. Gemeinsam bringen sie den Göttern ein Opfer. Gebannt verfolgen sie, wie ihr Priester und Häuptling zwei wunderschön verzierte Bronzedolche senkrecht in den Boden steckt und mit Erde bedeckt. Es ist ein beeindruckendes Schauspiel. Viele haben noch nie einen Bronzedolch in ihren Händen gehalten, in der Übergangszeit zwischen der späten Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit sind Flintdolche noch weit verbreitet.
Metalldetektor schlägt bei Bronze an
2017 läuft Frank Hoferichter über den Acker am Dorfrand. Er weiß (noch) nicht, dass wenige Zentimeter unter seinen Füßen einst ein heiliger Ort lag. Mit seiner Sonde ist der Kutenholzer wieder einmal auf der Suche nach weiteren Zeugnissen der Vergangenheit. Der Metalldetektor piept.

Kreisarchäologe Daniel Nösler, Sondengänger Frank Hoferichter und Professor Dr. Tobias Mörtz am Fundort (von links), hier steckten zwei Dolche senkrecht im Boden - an der höchsten Erhebung bei Kutenholz. Foto: Vasel
Vorsichtig holt Frank Hoferichter das erste kleine Bronzestück aus dem Boden. Wenig später entdeckt er beim Nachgraben ein zweites Dolchfragment. Hoferichter kann es immer noch nicht fassen: „Es war wie ein Sechser im Lotto.“

Blick auf die unrestaurierten Oberteile der Dolche. Foto: Universität Hamburg
Doch Hoferichter vertraut sich nur wenigen an. Er hält die Fundstelle fest und informiert den Stader Kreisarchäologen Daniel Nösler. Beide hüten das Geheimnis. Sie wollen keine Raubgräber anziehen. Nösler ist schnell klar: „Es handelte sich um einen extrem seltenen, herausragenden Fund.“ Nur Klingen und Griffe fehlten noch.
Kreisarchäologie holt Bronzezeit-Experten mit ins Boot
Acht Jahre später steht Sondengänger Frank Hoferichter wieder auf dem Acker. Die Kreisarchäologie hatte mit Professor Dr. Tobias Mörtz von der Universität Hamburg einen bekannten Fachmann für bronzezeitliche Waffendeponierungen in sogenannten Horten ins Boot geholt.
Sondengänger mit ihren Metalldetektoren und Mitarbeiter des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Universität Hamburg mit ihrem rollenden Geomagnetik-Messgerät suchten 2024/2025 den Fundort ab. Mithilfe der geomagnetischen Prospektion können Artefakte ohne Eingriffe in den Boden sichtbar gemacht werden. Im Bereich der erfolgversprechendsten Anomalien gruben sie sich auf vier Flächen in die Tiefe - mit Schaufel und Kelle.

Der Dolch steckte senkrecht im Boden. Foto: Vasel
Und sie wurden fündig, bereits in einer Tiefe von 30 Zentimetern. Hoferichter schaut auf eine Grube. Im Sand sind noch die Spuren des Pflugs zu sehen. Im Boden fanden sie in diesen Tagen zwei Klingen. Eine steckte noch wie vor 4000 Jahren senkrecht in der Erde, eine weitere lag fast senkrecht im Sand - fortgerissen vom Pflug.
Archäologen vereinen die Reste der Kultdolche von Kutenholz
Professor Dr. Tobias Mörtz und sein Kollege Daniel Nösler schauen begeistert auf die Funde. Die Klingen passen zu den Oberteilen, die Hoferichter ans Tageslicht holte. Mörtz schätzt, dass die Fragmente irgendwann zwischen 2000 und 1500 vor Christus von einem Handwerker gefertigt worden sind.

Die Archäologen haben die Funde mit weiteren Funden von 2017 zusammengesetzt, hier einer der beiden Dolche. Lediglich der Griff fehlt. Foto: Universität Hamburg
„Es ist ein Import aus dem Osten“, so Nösler mit Blick auf vergleichbare Stücke in Sachsen, Böhmen und Polen. Die Wissenschaft spricht von der Dolchzeit. Metalle waren noch selten, aus der Aunjetitzer Kultur stammte auch die Himmelsscheibe von Nebra.
Bronzedolche waren ein wertvolles Importprodukt aus dem Osten
Das Kupfer stammte vermutlich aus dem Karpatenbecken. Dort bauten Bergmänner das Kupfererz ab. Zinn wurde im Erzgebirge gewonnen. Auch Bergwerke im Harz, auf dem Balkan und aus den Alpen lieferten das Erz. Kupfer und Zinn beginnen bei etwa 850 Grad Celsius zu schmelzen. Neun Teile Kupfer vermischten die Handwerker mit einem Teil Zinn, dadurch wurde das Kupfer härter. „Bronze ist die erste künstlich hergestellte Legierung der Menschheit“, sagt Nösler. Es veränderte nicht nur die Wirtschaftsweise, sondern auch die Religion und die Sozialstruktur.
Sie vermuten, dass die Kultdolche von Kutenholz nicht benutzt worden sind. Die Ausgrabung im März 2025 habe gezeigt, dass es sich nicht um eine Grabbeigabe, sondern um einen Hort handelt. Spuren einer Bestattung oder eines Grabes gebe es nicht. In der Nähe sind allerdings zahlreiche Hügelgräber bekannt - unter anderem auch durch die Kurhannoversche Landesaufnahme von 1764/1786.

Bei der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1764/1786 wurden viele Grabhügel erfasst, rechts ist die Rekonstruktion eines Dolches zu sehen. Foto: Vasel
Die beiden Dolche (Kurzschwerter) seien gezielt vor rund 3500 oder möglicherweise deutlich mehr Jahren als eine kultische Gabe an übermenschliche Wesen („Götter“) oder aus ideologischen Gründen - beispielsweise zur Machtdemonstration oder Abgrenzung von anderen Gruppen - an dieser Stelle deponiert worden. Diese liegt laut Nösler 28 Meter über Normalhöhennull. Es ist die höchste Erhebung, diese bot sich als Heiliger Berg den Bronzezeit-Menschen geradezu an.
Bronzezeit-Kutenholzer pflegten weitreichende Handelskontakte
Diese lebten nicht hinter dem Mond, sie verfügten über Kontakte zu Kulturen in Mitteleuropa und der Mittelmeerregion. Die Eliten benötigten schließlich Rohstoffe wie Kupfer für ihre goldglänzenden Schmuckstücke oder Waffen aus Bronze. Die Menschen lebten auf Einzelgehöften und in Weilern - von Ackerbau und Viehzucht, immer weniger von Jagd und Fischen. Vor allem in Mooren und an Gewässern legten sie Depots an - und legten Beile, Kupferbarren und Wagenräder auch im heutigen Kreis Stade nieder. Vieles wurde hierzulande hergestellt.

Melike Fidan untersucht eine Steinsetzung. Foto: Vasel
Doch was gaben die Kutenholzer der Dolchzeit für ihre Kultstücke aus dem Osten? Kreisarchäologe Nösler vermutet: Felle, Vieh, Wachs, Honig oder sogar Sklaven - als Tauschobjekte. Die Grabung geht vermutlich 2026 weiter: Vielleicht finden sich noch Spuren einer Siedlung. Sondengänger Frank Hoferichter wird in die Geschichte eingehen - als Entdecker der Kultdolche von Kutenholz.

Kreisarchäologe Daniel Nösler hält Keramik in seiner Hand. Foto: Vasel