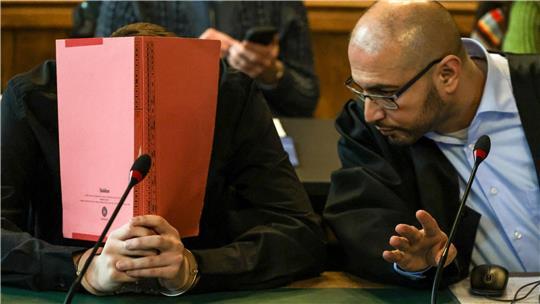TVerzögerungen: Wann das zweite LNG-Terminal im Jadebusen an den Start geht

Das Spezialschiff «Höegh Esperanza» liegt während der Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven vor Anker. In Wilhelmshaven wurde der erste Anleger für die Ankunft von Schiffen mit Flüssigerdgas fertiggestellt. Das LNG-Terminal wird heute in Betrieb genommen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Michael Sohn
Vor Wilhelmshaven wurde nach Beginn des Ukraine-Kriegs in Windeseile ein LNG-Terminal installiert. Jetzt soll das zweite kommen. Dabei ist von einer Gas-Mangellage keine Rede mehr. Brauchen wir das Terminal überhaupt? Und wann geht es in Betrieb?
Wilhelmshaven. Groß ist der LNG-Anteil am deutschen Gasimport nicht gerade; eigentlich ist er sogar ziemlich klein. In einer täglich aktualisierten Darstellung der Bundesnetzagentur schleicht die LNG-Linie mit etwa sieben Prozent am gesamten Import weiterhin am unteren Rand der Grafik entlang. Immer noch kommt der überwältigend große Anteil des Erdgases per Pipline ins Land – hauptsächlich aus Norwegen, aber auch aus den Niederlanden und Belgien. Aus Russland, dem ehemals größten Lieferanten, kommt im Zuge des Ukraine-Krieges seit Ende August 2022 nichts mehr.
Gas-Transport per Schiff ist deutlich teurer
Dass der Pipeline-Anteil nach wie vor so groß ist, liegt zum einen daran, dass es die entsprechende Infrastruktur schon lange gibt. Die Möglichkeiten, Erdgas in verflüssigter Form, also als LNG per Schiff ins Land zu holen, existiert hingegen erst ein gutes Jahr; und das bisher nur an wenigen Terminals - einer davon liegt vor Butjadingens Haustür, nämlich im Jadebusen an der Küste Wilhelmshavens.
Auch der Kostenfaktor spielt eine Rolle: Der Transport per Schiff ist deutlich teurer, da das Erdgas für die Passage erst verflüssigt werden muss, um es dann am Zielort wieder zu regasifizieren. Beides sind energieaufwendige Prozesse.
Warum noch ein LNG-Terminal?
Dennoch ist vor Wilhelmshaven ein Anleger für ein zweites LNG-Terminal entstanden. Der Grund? „Das ganz große Thema ist hier die Versorgungssicherheit“, sagt dazu Andreas van Hooven. Er gehört zur Deutschen Energy Terminal GmbH (DET), eine bundeseigene Gesellschaft, eigens gegründet, um vier vom Bund gecharterte schwimmende LNG-Terminals zu betreiben und zu vermarkten. Drei sind schon in Betrieb, eines in Brunsbüttel, eines in Stade und eines in Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven kommt nun noch ein zweites Terminal hinzu. Außerdem gibt es eine kleinere, privat betriebene Anlage in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern).
Nicht zuletzt die Industrie ist auf das Gas angewiesen
Um die Notwendigkeit eines weiteren Terminals zu verdeutlichen, nennt Andreas van Hooven eine Zahl: Gut 90 Prozent des in Deutschland benötigten Gases würden importiert, man sei also nach wie vor in hohem Maße abhängig, sagt er. Auch die guten Füllstände in den Gasspeichern seien kein Gegenargument zum Bau der Terminals. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher noch zu gut 66 Prozent gefüllt, so ist es auf der Seite der Gas Infrastructure Europa (GIE) nachzulesen.
„Wenn wir jetzt keinen Nachschub mehr bekämen, würden wir nur noch zwei Monate versorgt sein“, so Andreas so van Hooven. Das wäre für Privathaushalte mit dem beginnenden Frühling vielleicht zu verschmerzen. Anders sähe es aber bei Industriekunden aus. Heißt: Alle vier seien nötig, versichert der Experte.
Wann kommt das zweite LNG-Terminal?
Eigentlich wollte das Energieunternehmen TES das zweite schwimmende Terminal in Wilhelmshaven noch im Winter in Betrieb nehmen. Daraus wird aber nichts. Auch wenn das Terminal unter das LNG-Beschleunigungsgesetz fällt, haben sich die Genehmigungsverfahren verzögert. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat im März die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Abwassern von dem Terminal erteilt. Nach Auskunft von Pressesprecherin Bettina S. Dörr fehlt aber noch der Planfeststellungsbeschluss zum Gewässerausbau für den Anleger. Dieser Beschluss werde aktuell vom NLWKN vorbereitet.
NLWKN rechnet mit Inbetriebnahme im Juli
Außerdem steht die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Betrieb des Terminals noch aus. Sie werde aktuell vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg (GAA) erstellt, teilt Bettina S. Dörr mit. Das NLWKN geht davon aus, dass das Terminal im Juli in Betrieb gehen wird.
Unterdessen ist der neue Anleger soweit fertig: Etwas südlich vom ersten Terminal wurde eine Art Inselpier errichtet - bestehend aus zehn Dalben, die in etwa zwei Kilometern Entfernung vom Festland in den Nordseeboden gerammt wurden. Daran wird das Schiff festmachen und für die nächsten fünf Jahre auch liegen. Eine feste Verbindung zum Festland - etwa in Form eines Stegs - gibt es nicht. Die Leitungen, um das regasifizierte Gas vom Schiff ans Festland und dann weiter zum nächsten Knotenpunkt ins Gasnetz zu transportieren, liegen auf dem Meeresboden.
Kommen noch mehr Chlor-Einleitungen?
Das Spezialschiff für das zweite Terminal im Jadebusen ist die „Excelsior“. Sie liegt aktuell in einer Werft in Spanien, wo sie auch umgestrichen und umgerüstet wurde, wie Gerd Töpken von der Firma Engie sagt. Zusammen mit der Firma TES errichtet Engie für die DET den Anleger für die „Excelsior“. Wie das benachbarte LNG-Terminal „Höegh Esperanza“ ist die „Excelsior“ eine schwimmende Industrieanlage und mit 277 Meter Länge nur geringfügig kleiner als ihre Nachbarin.
Über die „Excelsior“ sollen künftig jährlich fünf Milliarden Kubikmeter Gas ins Land geholt werden können, ebenso viel wie über die „Esperanza“. Die ging im Dezember 2022 als erstes deutsches LNG-Terminal in Betrieb. Hier hatte das Energieunternehmen Uniper den Anleger für das Schiff vorbereitet.
Diesmal Ultraschallverfahren zur Reinigung der Rohrleitungen
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Schiffen ist das Prinzip, mit dem die Rohrleitungen für das Seewasser sauber gehalten werden. Beide nutzen das Seewasser – konkreter: dessen Temperatur –, um das tiefgekühlte verflüssigte Gas zu erwärmen. Dadurch wird es wieder gasförmig. Das Meerwasser wird dazu per Leitungssystem durch das Schiff geschleust; praktisch um das flüssige Gas herum. Auf der „Esperanza“ wird zur Reinigung dieser Leitungen ein Biozid verwendet, am Ende des Prozesses gelangt Chlor ins Meerwasser. Umweltverbände hatten dieses Verfahren scharf kritisiert.

Von dem LNG-Terminal „Höeg Esperanza“ wird chlor- und bromhaltiges Abwasser in die Nordsee geleitet. Dagegen hatten Umweltschützer protestiert. Foto: Hauke-Christian Dittrich
Auf der „Excelsior“ wird nun ein Ultraschallverfahren angewendet. In diesem Fall gibt es laut NLWKN keine Einleitung von Bioziden wie bei der „Esperanza“. Darauf basiert auch die wasserrechtliche Genehmigung, die der Landesbetrieb erteilt hat.
Bei Rammarbeiten Rücksicht auf Schweiswale genommen
Auch in anderer Hinsicht scheint man sich bei den Bauarbeiten für das zweite Terminal einige Mühe gegeben zu haben, Tier- und Umweltschutzbelangen gerecht zu werden. Die Rammarbeiten für den Liegeplatz der „Höegh Esperanza“ waren von Umweltschützern ebenfalls kritisiert worden. Der Lärm beeinträchtige unter anderem stark die im Jadebusen lebenden Schweinswale.
Beim Rammen der Dalben für den „Excelsior“-Anleger wurde jetzt eigens eine Art Schallschleier um die Baustelle unter Wasser gelegt: Am Meeresboden wurde ein punktierter Schlauch positioniert, in den Luft gepumpt wurde, so dass vom Grund ein kreisrunder Schleier aus Luftbläschen emporstieg. Auf diese Weise sollten die Schallwellen unter Wasser verringert werden.