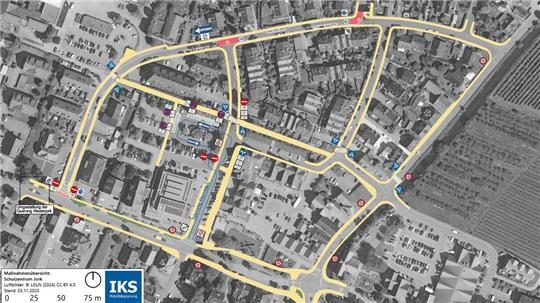THochwasser im Kreis Stade: Erste Entwarnung – Jetzt werden Konsequenzen gefordert

Die Hochwasser-Lage im Landkreis Stade ist weiter unter Beobachtung. Foto: Vasel
Die Alarm-Apps schlugen als erste an und gaben am Mittwoch Entwarnung. Doch vollgelaufene Keller und überflutete Gärten - damit soll an der Oberen Lühe endlich Schluss sein. Doch der Deichverband macht den Betroffenen wenig Hoffnung.
Landkreis. Die Nerven liegen vielerorts blank. Drei Tage lang sorgten sich die Anwohner an der Oberen Lühe um ihr Hab und Gut. Keller liefen voll, Gärten standen unter Wasser. Nachbarn halfen sich untereinander, andernorts rückten Feuerwehrleute an und pumpten Keller leer. Auch Bürgermeister Gerd Grunwald aus Neuenkirchen war betroffen, er warf seine Pumpen an und montierte Flutschotts vor die Fenster. Handhoch stand das Wasser im Keller.
„Das geht an die Substanz, wir sind drei Tage lang nicht zur Ruhe gekommen“, sagt Grunwald. Jan Schuback aus Guderhandviertel sicherte sein Haus mit 15 Helfern mit Sandsäcken. Nils Menge aus Altenschleuse räumte seine Schuppen aus, fuhr die Pkw weg. Das Wasser schoss durch die Steckdosen ins Haus.
Entwarnung: Keine Hochwasser-Lage mehr im Landkreis Stade
Am Mittwoch gab es vorläufig Entwarnung für den Landkreis Stade. Derzeit gebe es keine Bedrohung durch die Hochwasser-Lage mehr, die Situation entspanne sich deutlich, hieß es vom Landkreis. Dennoch blieben Deiche und Flussläufe unter Beobachtung. Über die Weihnachtsfeiertage hatte es mehr als 110 Einsätze gegeben.
Mehr als 100 Einsätze
T Noch keine Entwarnung nach Hochwasser-Alarm im Landkreis Stade
Feuerwehr
T Hochwasser-Alarm: So ist die Lage im Kreis Stade
Begrenzt lokal bleibt die Hochwasser-Lage dennoch niedersachsenweit sehr angespannt. Insgesamt meldeten 71 von 97 Pegeln Hochwasser, davon 40 die höchste Meldestufe 3. Und das Innenministerium warnt: Wegen der angesagten Regenfälle könnte sich die Situation am Silvester-Wochenende erneut verschärfen. „Unter gebührender Berücksichtigung der Unsicherheiten muss konstatiert werden, dass die Gefahr kräftigerer Niederschläge wieder deutlich zunimmt“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. „Insbesondere im Westen und Nordwesten deuten die Wettermodelle viel Nass an, das die Flusspegel wohl wieder rasch ansteigen lassen wird.“ Wie groß die Dauerregen- und Hochwassergefahr tatsächlich ausfällt und welche Regionen besonders davon betroffen sein werden, kann der DWD derzeit noch nicht sagen.
Das Land werde die Kommunen mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz und dem Kompetenzzentrum für Großschadenslagen weiterhin unterstützen, versprach Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch. Dazu gehöre die Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten oder die Organisation von Sandsäcken aus anderen Bundesländern.
Lühe-Anrainer wollen nicht am Stausee leben
Das Wasser laufe seit dem Bau der neuen Hochwasserschutzanlagen in Horneburg in den Jahren 2002 bis 2015 an der Oberen Lühe höher auf, so Schuback und Menge. Die Überlaufschwelle in Horneburg liegt bei knapp 2,30 Meter über Normalhöhennull. Beim alten Aue-Deich floss das Wasser der Aue/Lühe bereits ab 2,15 Meter in den Bullenbruch. Im Februar 2022 und im Dezember 2023 hätten Außendeichsflächen unter Wasser gestanden, die seit dem Bau des Alten Lühe-Sperrwerks im Jahr 1932 nicht mehr oder selten überflutet worden seien. Notwendig seien jetzt Maßnahmen, um die Anrainer zu entlasten.

Blick auf den Lühe-Deich in Guderhandviertel, das Wohnhaus rechts im Außendeich stand am Montagmorgen unter Wasser. Foto: Vasel
Die Überlaufschwelle der Hochwasserentlastungsanlage Bullenbruch, so Oberdeichrichter Wilhelm Ulferts, könne - wie von Lühe-Anliegern und Samtgemeindebürgermeister Timo Gerke gefordert - nicht einfach heruntergesetzt werden. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens war die Entschädigungsfrage mit den Landwirten geregelt worden, rein rechnerisch wäre mit einem 500.000-Euro-Schadensfall in 100 Jahren zu rechnen. Bei einer Herabsetzung um zehn Zentimeter wäre es die zehnfache Summe, die die Kommunen im Einzugsbereich aufbringen müssten, die mit dem Hochwasserschutzverband Aue/Lühe den Bullenbruch-Polder nach Fertigstellung vom Deichverband in Jork übernehmen werden. Die Ausbau-Höhe war ein Kompromiss, um Klagen zu vermeiden. Doch die Anwohner betonen auch, dass sie durch den Bau nicht zusätzlich belastet werden dürften.
Wassermassen stauen sich an den Lühe-Brücken
Doch das Notventil bringt den Altländern nicht die große Entlastung. Das liegt auch an hausgemachten Problemen. So ist 2000 der Fuß der samtgemeindeeigenen Brücke zwischen Neuenkirchen und Guderhandviertel in den Flusslauf hinein verbreitert worden. Deshalb fehlen an der „Neubrück“ links und rechts jetzt jeweils 1,80 Meter. Hier seien die beiden Gemeinden und die Samtgemeinde gefordert. „Der Durchfluss reicht nicht aus, das Wasser staut sich“, sagte Ulferts im Gespräch mit Anliegern. Hinzu kommt, dass es in der Lühe kein natürliches, sondern lediglich ein hydraulisches Gefälle (durch Ebbe und Flut) gebe. Weitere Problempunkte seien Steinschüttungen im Flusslauf in Brückenbereichen und vermutlich auch die „Schmalbrück“ zwischen Guderhandviertel und Mittelnkirchen. Danach fließt das Wasser wieder problemlos ab - in Richtung Elbe.
Während des Hochwasser-Alarms hatten Deichverband und die Wasser- und Bodenverbände vereinbart, nicht in die volle Aue/Lühe zu pumpen. Zum Schutz der Häuser binnendeichs in den Dörfern und der Obstanlagen, allein in Neuenkirchen stehen Anlagen im Wert von 30 Millionen Euro, hätten die Flächen in der Feldmark nicht geflutet werden können, um die Anlieger im Außendeich zu entlasten, so Vize-Oberdeichrichter Hans-Jürgen Bremer. „Wir müssen pumpen“, sagt Bremer. Und: Im Wasserrecht würden sofort Entschädigungen greifen, die die Verbände finanziell gar nicht leisten könnten. Die Lühe-Anrainer im Außendeich hingegen meinen, dass in den Obstplantagen noch Luft sei. Doch das, so Bremer, würde nicht nur das Eigentum der Obstbauern, sondern auch Wohnhäuser binnendeichs gefährden, die nicht im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet lägen.

Die Ortsfeuerwehr sichert Trafos am Poggenpohl. Foto: Vasel
Wer zwischen den Deichen wohnt, muss sich selbst schützen
Die Lühe-Anlieger setzen auf die Politik, sie fordern einen Wassermanagementplan - für Ober- und Unterlauf. Doch die Kommunalpolitiker müssten dicke Bretter bohren - in Hannover und in Stade. Schließlich stehen die Häuser auf und am Deich in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet.
Das heißt: Wer zwischen den Deichen wohnt, ist laut Gesetz verpflichtet, sich selbst zu schützen. Das könne durch bauliche Maßnahmen wie Schotts vor Keller-Fenster und -Türen und/oder das Vorhalten von Tauch-Pumpen und Sandsäcken geschehen.

Anlieger treffen Deichverband: Wilhelm Ulferts, Nils Menge, Jan Schuback, Hans-Jürgen Bremer und Gerd Grunwald (von links). Foto: Vasel
„Bis zu einer Höhe von bis zu 2,60 Meter“, verweist Bremer auf die Rechtslage. Für die Anlieger sei das so nicht akzeptabel, so Grunwald. Zur Einordnung: Der Wasserstand lag an der Oberen Lühe während des Hochwasser-Alarms über die Weihnachtsfeiertage in der Spitze zwischen 2,30 Meter und 2,42 Meter über Normalhöhennull. „Mit Wasserständen von 2,30 Meter könnten wir leben“, betont Grunwald.
Altländer fordern Schöpfwerk an der Elbe
Deichverband und unmittelbare Lühe-Anlieger wollen bei der Küstenschutzkonferenz in Stade im Januar dafür werben, dass der Flaschenhals „Neubrück“ durch einen Neu-/Umbau verschwindet. Des Weiteren, so Grunwald, sollte ein Hochwasserschutzberater die (Neu-)Bürger über Schutzmaßnahmen informieren. Der war bei der Samtgemeinde Lühe dem Rotstift zum Opfer gefallen. Viele Neubürger benötigten Infos. Die gibt es auch auf der Landkreis-Homepage. Auch im Oberlauf müsse weitere Rückhaltung geschaffen werden.

Staustufe: Blick auf die Brücke ("Neubrück") zwischen Guderhandviertel und Neuenkirchen. Foto: Vasel
Ulferts will im Januar mit dem Landrat auch beim Land Niedersachsen Druck machen, eine Viertel-Ingenieursstelle für den Hochwasserentlastungspolder im Bullenbruch reiche nicht aus. Er will erreichen, dass 2024/2025 die Schöpfwerke gebaut und die zu niedrigen Deichstellen, etwa am Poggenpohl, vorgezogen werden. Langfristig, so der Oberdeichrichter, müsste mit dem geplanten neuen Lühe-Sperrwerk auch ein Spitzen-Schöpfwerk errichtet werden, so dass bei Starkregen und Sturmflut - bei geschlossenen Stemmtoren - in die Elbe gepumpt werden kann, um die Anlieger und Deiche zu entlasten.