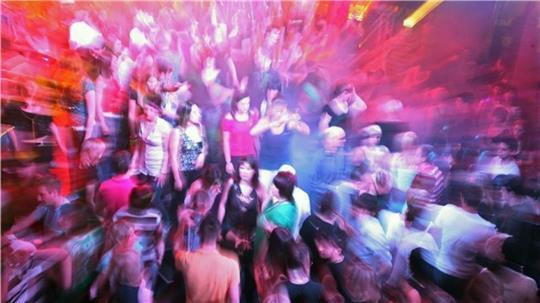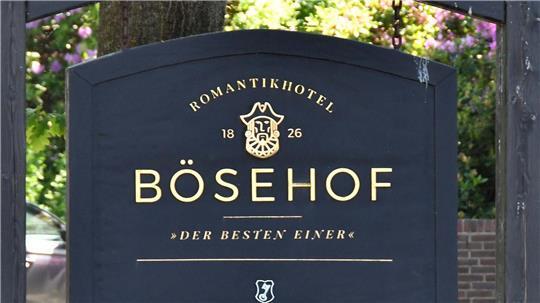TJäger: Darum sind gerettete Rehkitze schlecht fürs Klima

Ein zuvor von freiwilligen Helfern gesuchtes Rehkitz wird auf einem Acker in einen Korb gelegt. Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Rolle des Jägers hat sich durch den Klimawandel verändert. In vielen Regionen sichern sie den Arten- und Waldbestand. Doch damit das gelingt, müssen Jäger ihre Abschusspläne ändern. Schuld daran sind Damwild und Rehe.
Jagd ist keine reine Freizeitbeschäftigung mehr, sagt Jäger und Revierpächter Siegfried Rakowitz aus Zeven. „Heute ist es unsere Aufgabe, für angepasste Wildbestände in unseren Wäldern zu sorgen.“ Angepasst heißt: Die Bestände von Rehen, Rot- und Damwild soweit zu regulieren, dass der Umbau von reinen Fichtenbeständen hin zu stabilen Mischwäldern gelingen kann. „Die jagenden Förster allein können das nicht schaffen, jeder einzelne Jäger ist gefragt“, unterstreicht Rakowitz.
Schon seit mehr als 40 Jahren werden die Wälder hierzulande umgebaut. Reine Fichtenbestände sind passé. Ziel sind Mischwälder mit hohem Laubwaldanteil. Das veränderte Klima forciert die Sache. Trockenperioden stressen die Fichte genauso wie anhaltender Dauerregen. Zudem treten Schadinsekten wie die Borkenkäfer massenhaft auf und bringen die Fichten zum Absterben. Allein im Harz sind fast 30.000 Hektar Waldfläche verloren gegangen oder massiv geschädigt.
Wälder sollen sich heute natürlich verjüngen
„Intakte, stabile Mischwälder sind eines der wichtigsten Instrumente der Klimastabilisierung“, sagt Rakowitz. Dazu bedarf es Neuanpflanzungen, vor allem aber der natürlichen Verjüngung des Waldes. Man setzt dabei auf die kleinen Pflänzchen, die aus den Samen der Altbäume im Wald hochkommen. Die Naturverjüngung, also die Reproduktion eines Baumbestandes, gilt als wirtschaftlich und ökologisch. Nur: Die Fichte hat dabei keine Chance. Sie wird beim Waldumbau mehr und mehr ausselektiert.

So sieht sie aus, die Naturverjüngung. Die aus den Samen der Altbäume hervorgegangenen Pflänzchen bilden den Wald der Zukunft. Weißtanne, Douglasie und Lärche werden gefördert, Fichten werden bis auf wenige Exemplare mit der Zeit entnommen. Foto: Jakob Brandt
„Die Fichte fällt immer mehr aus“, sagt Rakowitz. „Im Norden der Republik ist sie schon auf großer Fläche abgestorben.“ Sie ist ein Flachwurzler und verträgt keine Trockenphasen. Auch längere Regenphasen schaden der Baumart, im Matsch fangen ihre Wurzeln schnell an zu faulen, und kommt Sturm auf, fallen die Bäume um. „Wir werden nur ganz geringe Fichtenbestände behalten“, prognostiziert Rakowitz, der als Leiter der Revierförsterei Bevern über einen großen Erfahrungsschatz in puncto Forstwirtschaft verfügt.
Ohne Jäger geht es nicht
Der Wechsel auf klimastabilere Baumarten wie Weißtanne, Douglasie, Lärche, Eiche, Roteiche, Bergahorn, Esche, Erle und Birke läuft auf Hochtouren. Es gibt nur ein Problem: Sind die Bäume noch klein, schmecken sie dem Wild vorzüglich und werden gern verbissen. Besonders auf die Weißtanne hat es das Wild abgesehen. Nicht die Nadeln, der Haupttrieb ist ihre Lieblingsspeise. „Wird er zweimal abgefressen, ist die Pflanze zum Absterben verurteilt“, erläutert Rakowitz. Um das zu verhindern, müssen in unserer Region Rehe und Damwild in Schach gehalten werden.

Ein reiner Fichtenwald gehört der Vergangenheit an. Immer mehr Bäume dieser Art sterben ab. Laubbäume, Weißtanne, Douglasie und Lärche sind die Zukunft. Doch dem Wild schmecken diese Bäume, wenn sie klein sind, besonders gut. Foto: Jakob Brandt
Bei der Naturverjüngung des Waldes spielen Jäger eine entscheidende Rolle. „Ohne sie geht es nicht“, sagt Siegfried Rakowitz. „Es ist unsere Kernaufgabe, mit jagdlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass die Waldverjüngung klappt.“ Es gehe nicht darum, Rehe und Damwild auszurotten, sondern darum, für „angepasste“ Wildbestände zu sorgen. Durch eine fundierte Ausbildung, langjährige Erfahrung und angemessene Bejagungskonzepte seien die Jäger in der Lage, den Waldumbau zu gewährleisten.
Ziel ist, ein Drittel des Wildbestandes zu entnehmen
Den Einsatz der Nachtzieltechnik lehnt der passionierte Jäger, wie die allermeisten seiner Kollegen, aus ethischen Aspekten entschieden ab. Die nächtliche Jagd führe zu einer ständigen Beunruhigung des Wildes, weil es sich zu keiner Zeit mehr in Sicherheit fühlen könne. „Ich bin der Meinung“, sagt Rakowitz, „dass die Verbissschäden dann sogar größer werden, weil sich das Wild weit in den Wald zurückzieht, dorthin, wo wir den Wald verjüngen wollen.“

Der Jäger als Artenschützer. Viele Jäger legen heute Teiche an, pflanzen Hecken und säen Wildäcker ein. Alles Projekte, von denen viele Tier- und Pflanzenarten profitieren - und nicht nur das jagdbare Wild. Foto: Jakob Brandt
Was heißt nun „angepasste Bejagung“? „Wir werden wohl jedes Jahr ein Drittel des Bestandes entnehmen müssen“, führt Rakowitz aus. Der Jäger weiß, dass es vielleicht nicht ausreicht. Denn die Rehkitzrettung mit der Drohne hat zwei Seiten. Weil deutlich mehr Kitze vor dem Mähtod bewahrt werden, gibt es deutlich mehr Rehe, die Heißhunger auf junge Tannentriebe haben und für mehr Wildunfälle auf den Straßen sorgen. „Vielleicht müssen wir unsere Abschusspläne dieser Entwicklung anpassen“, räumt Rakowitz ein.
Beim Waldumbau löste die Eiche die Buche ab
Unter den Laubbäumen nimmt die Eiche beim Waldumbau eine besondere Rolle ein. Sie gilt wegen ihrer Pfahlwurzel, mit der sie in tiefere Bodenschichten vordringen kann, als klimastabiler als die Buche, die bisher Favorit der Forstwirte war. Im Gegensatz zur Buche, die sich natürlich verjüngen lässt, wird die anspruchsvolle Eiche meistens angepflanzt.
Da sie die am stärksten verbissene Laubbaumart ist, müssen Neuanpflanzungen als Schutz vor Wild eingezäunt werden. Und die Anpflanzung ist teuer. 7.000 junge Pflänzchen werden auf einen Hektar gesetzt. Kosten: 12.000 Euro. „Zehn Jahre muss ein Schutzzaun stehen bleiben“, sagt Rakowitz. Naturverjüngung ist günstiger.