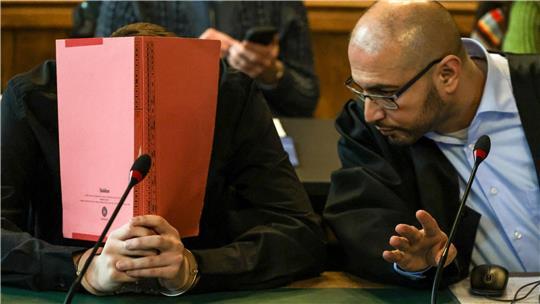TDeichtorhallen-Chef Luckow: Diese Ausstellungen sind „Augenwischerei“

Dirk Luckow, seit 2009 Herr über die Deichtorhallen für Kunst und Fotografie. Foto: Philipp Meuser
Bevor das Interview mit dem Deichtorhallen-Intendanten Dirk Luckow beginnt, bittet er kurz in die Ausstellung „Franz Gertsch – Blow-Up. Eine Retrospektive“.
Was macht die Lange Nacht der Museen für Sie so besonders?
Dirk Luckow: Sie holt offensichtlich auch jene Menschen ab, die sonst nicht unbedingt ins Museum gehen. Es gibt überall Führungen und man bekommt die Chance, die unterschiedlichen Profile der Ausstellungshäuser kennenzulernen. Zudem ist die Lange Nacht der Museen eine Art Riesenhappening. Die Besucher sind mit ihren Familien und Freunden unterwegs und tauschen sich über das Gesehene aus.
Wo trifft man Sie in der Langen Nacht der Museen?
Ehrlich gesagt verbringe ich die Zeit meistens in den Deichtorhallen. Weil ich ein Stück weit der Kapitän dieses Schiffs bin und bei Bedarf auch mal irgendwo einspringe.
Während der Langen Nacht der Museen sind in der Schau „High Noon“ Bilder der Fotografin Nan Goldin zu sehen. Sie hat bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in Berlin Israel des Völkermords im Gazastreifen bezichtigt. Haben Sie danach überlegt, ob Sie ihre Fotos überhaupt zeigen können?
Natürlich haben wir diese Frage diskutiert. Bei uns ist die Situation aber völlig anders als in Berlin. Wir präsentieren keine Einzelausstellung, sondern Werke aus der Sammlung Gundlach von Nan Goldin und Freunden aus ihrer Bostoner Zeit. Es handelt sich also um eine reine Sammlungspräsentation, bei der die Künstlerin nicht konzeptionell beteiligt war. Sicher hätten wir nicht gewollt, dass Nan Goldin die Deichtorhallen als Bühne ihres Aktivismus im Kontext des Gazakrieges nutzt. Dennoch wissen wir ihren Aktivismus auf anderen Gebieten durchaus zu schätzen. Gegen den Sackler-Konzern, dem vorgeworfen wird, maßgeblich für die Opioid-Krise in den USA verantwortlich zu sein, hat sie wirklich etwas bewirkt.
Kann man mit Fotos von Nan Goldin oder David Armstrong im Zeitalter der Smartphones Menschen eher erreichen als mit Malerei?
Ich habe schon immer gedacht, dass die Fotografie schneller und direkter an gesellschaftlichen Umbrüchen und auch Krisen dran ist als andere Medien. Dafür hat die Bildende Kunst einen längeren Atem. Franz Gertsch zum Beispiel spricht die Menschen mit seiner Malerei an, weil seine Werke einen zeitlosen Blick eröffnen und die Betrachtenden schon ob ihrer Größe regelrecht darin versinken lassen.
Was halten Sie eigentlich von immersiven Van-Gogh- oder Klimt-Ausstellungen?
Für mich ist das im wahrsten Sinne des Wortes Augenwischerei. Monumental-bewegte, kitschige Bilder können doch etwa Frida Kahlos Realität in Mexiko gar nicht widerspiegeln. Dass ihre Welt nicht heil, sondern voller innerer Konflikte und Kämpfe gegen die gesellschaftlichen Konventionen war, spürt man in ihren Originalwerken unmittelbar. Kunst hat eben die Kraft, Menschen zu überraschen, Geist und Seele tiefgehend zu berühren, statt nur die Augen zu reizen.
Auch die Begegnung mit den Bildern der Schau „How’s my Painting“ in der Sammlung Falckenberg ist intensiv. Wie war es für Sie, nach Harald Falckenbergs Tod erstmals eine Ausstellung ohne ihn zu konzipieren?
Wir haben uns meistens sehr schnell auf Themen und Konzepte mit Harald Falckenberg einigen können. Gleichzeitig wurde auch stets viel diskutiert. 2019 haben wir die Installationen und Objekte in den Mittelpunkt einer Sammlungspräsentation gestellt. Nun folgt die Malerei als ein weiterer Schwerpunkt seiner sammlerischen Tätigkeit, um auch diese einem breiteren Publikum vorzustellen. Allerdings auf eine Art, die Harald Falckenberg möglicherweise nicht gefallen hätte.
Warum nicht?
Einfach weil er weniger nach Medium als vielmehr nach Haltung gesammelt hat. Diese Offenheit und Reflexionskunst prägen sein Sammeln. Es war frei von ästhetischen Dogmen, stattdessen voller Inhaltlichkeit. Dafür eignet sich aber, wie wir finden, das Genre der Malerei perfekt – dank seiner ganzen Geschichte, Rhetorik und Intellektualität.
Hat Harald Falckenberg das Subversive gesucht?
Ja. Auch das Subkulturelle, das Politische, das Institutionskritische. Ihn hat das fasziniert, was unter der Fassade ist. Etwas, das die Gesellschaft womöglich als bedrohlich wahrnimmt, wenn es aufgedeckt wird. Eines von Harald Falckenbergs Lieblingsbildern war Martin Kippenbergers „Selbstjustiz durch Fehleinkäufe“. Darin hat er sich wiedergefunden, weil er in seiner Sammlung Position und Gegenposition vereinigt hat. Er hat sie erweitert und pointiert – Irrtum, Fehler und natürlich Humor inklusive.
Harald Falckenberg hat zeitweilig mit dem Künstler Werner Büttner in einer WG gewohnt. Hat er sich deshalb in die Kunst vertieft?
Werner Büttner scheint den entscheidenden Anstoß gegeben zu haben. Harald Falckenberg war Jurist und Unternehmer, gleichzeitig mag ihn das Gesellschaftliche auch etwas gelangweilt haben, weshalb ihn die Kunstwelt immer fasziniert hat. Bereits während seines Jurastudiums setzte er sich mit babylonisch-assyrischer Keilschrift auseinander. Schon daher rührte sein Interesse an Kunst, die man entschlüsseln muss – ein roter Faden, der sich in all seinen gesammelten Werken wiederfindet.
Mit welchem Bild hat Harald Falckenberg dann den Grundstein für seine Sammlung gelegt?
Mit Bill Beckleys „Running from Spots“. Es hat verschiedene Ebenen – Textpassagen, kunsthistorische Verweise oder abstrakte Seiten. Dieses Werk erschließt sich Stück für Stück in seiner Vielschichtigkeit.
Welche Bedeutung hat die Sammlung Falckenberg für die Kunstwelt?
Sie ist ein andauerndes „Anti“ – gegen die Hauptströme der Kunst. Harald Falckenberg hat nie aus Prestigegründen gesammelt. Er wollte die zeitgenössische Kunst wirklich verstehen. Darum hat er die Künstler gefragt: „Wer war für euch wichtig?“ Dann hat er auch diese Pfade weiterverfolgt und die Vorgänger gesammelt. So konnte er Generationen der Counter Culture, der Gegenkultur, von inzwischen international bekannten Künstlern, in seiner Sammlung zusammenbringen.
Hatte er als Sammler eine konkrete Philosophie?
Harald Falckenberg hat sich unter anderem für den Ansatz des amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Henry David Thoreau interessiert: Wenn der Staat oder die Gesellschaft in eine falsche Richtung laufen, kann man subjektiv dagegen einschreiten. Bis hin zum zivilen Ungehorsam. Gleichzeitig war ihm das juristisch Korrekte bis zuletzt extrem wichtig. Dieser Ausgangspunkt ist hochaktuell – besonders in Bezug auf die gegenwärtigen Krisen, Kriege oder Autokratien. So gesehen sind die Werke der Sammlung Falckenberg vorausschauend und nah am Puls der Zeit.
Sie ist in den Phoenix Fabrikhallen in Harburg untergebracht, in diesem Stadtteil gibt es einen hohen Anteil migrantischer Mitbürger. Wie wollen Sie es schaffen, diversere Zielgruppen ins Museum zu holen?
Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Schulen zusammen. Außerdem bieten wir Familientage und vielfältige Formen von Führungen – etwa Deutsch als Fremdsprache – an, die sich an ganz unterschiedliche Zielgruppen richten. Trotzdem bleibt es eine große Herausforderung, die komplexen Inhalte der Sammlung Falckenberg für alle zugänglich zu machen. Einfach weil sie einem ziemlich viel abverlangt – aber genau das macht auch ihren Reiz aus. Harald Falckenberg hat immer gesagt: „Durch diese Sammlung muss geführt werden. Die Werke brauchen Erklärungen.“
Heißt das, sie erschließt sich lediglich Kunstkennern?
Nein, überhaupt nicht. Mein Ansatz ist: Unabhängig von der Herkunft und der kulturellen Vorbildung kann jeder Mensch von einem Werk mitgerissen werden. Insofern stehen die Tore unserer Häuser allen Menschen offen. Unser Ziel ist es, langfristig noch mehr niedrigschwellige Angebote in unser Programm einzubinden, wie zum Beispiel aktuell Führungen mit der eindrucksvollen Drag Queen Didine van der Platenvlotbrug, die zusätzlich zur kunsthistorischen Perspektive auch eine humorvolle Ebene mit reinbringt.
Zur Person – New York, Kiel, Hamburg
Dirk Luckow wurde am 24. September 1958 in Hamburg geboren. In Berlin studierte er Kunstgeschichte, Archäologie und Alte Geschichte. Der Vater von drei Kindern war unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Solomon R. Guggenheim Museum in New York. 2002 wurde er zum Direktor der Kunsthalle zu Kiel berufen, damit war er auch geschäftsführender Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Kunstvereins Kiel. Seit 2009 ist er Intendant der Deichtorhallen Hamburg.
Dem Kunsthistoriker und Kurator ist es ein Anliegen, ein diverses Publikum in die Deichtorhallen zu holen. Deshalb wird es im Haus der Photographie, das derzeit saniert wird, ein Bild- und Medienzentrum geben. Dort wird man sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigen können. KI-Kunst findet Luckow einerseits interessant, andererseits vermisst er bei ihr das Authentische.
Persönlich – Faszination Fotografie
Kunst ist für mich … Erkenntnis und Anstoß, meine Sinne zu öffnen.
Mein Lieblingskünstler ist … Vincent van Gogh.
Fotografie fasziniert mich …, weil sie die Wirklichkeit zeigt, wie sie ist – jedoch in unerwarteter Weise.
Mein Lieblingsbild in der Ausstellung „How’s my Painting“ … ist Bjarne Melgaards „Son and Dad“.
An Franz Gertsch beeindruckt mich am meisten …, dass seine Werke aus der Ferne so fotografisch und von Nahem so abstrakt wirken.
Pop Art finde ich … interessant, wenn sie es schafft, über den Aspekt der Medien und der Warenwelt hinauszugehen.