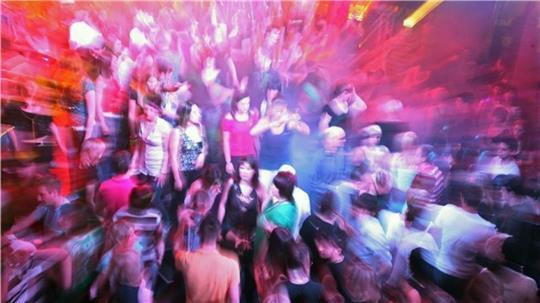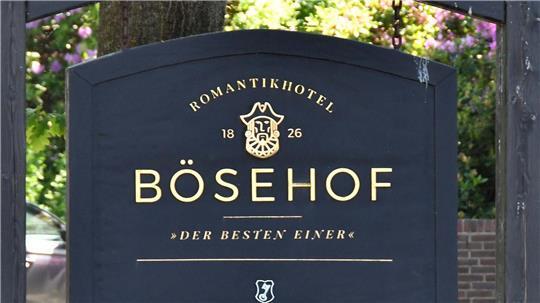TDoris Urban rettet Hunde vorm drohenden Tod

Die achtjährige Lotta war eine der ersten Pflegehunde von Doris Urban. Die Tierschützerin hat ihr Haus in Neuenkirchen im Land Hadeln nach der Hündin benannt: „Lotta im Glück“. Foto: Arnd Hartmann
Wenn Doris Urban nach Ungarn fährt, begleitet sie mindestens ein zum Tode verurteilter Hund zurück in den Stader Nachbarkreis. „Aber nicht jedem Hund tut man damit einen Gefallen, ihn hier her zu holen“, weiß die 49-Jährige.
Fast in Zeitlupe nähert sich Doris Urban ihrem Badezimmer. Die Tür steht offen aber ein Gitter verschließt den Durchgang. Dahinter starren ihr schreckgeweitete Augen entgegen. Die schwarze Mischlingshündin Tara rollt sich noch kleiner zusammen, verkriecht sich in einer Ecke, als würde sie um ihr Leben fürchten. Leise aber ohne zu zögern öffnet die Tierschützerin das Gitter und setzt sich auf den Boden. Der verängstigten Hündin widmet sie keinen einzigen Blick.
Deutlich weniger vorsichtig hüpft der kleine Tobi hinterher. Der sechs Monate alte Welpe tappst munter auf Tara zu, kugelt sich auf der Hundedecke herum und lässt sich von Doris Urban kraulen. Die dreijährige Angsthündin guck skeptisch, bleibt aber liegen. „Das hier ist schon Therapie-Arbeit“, sagt die 49-Jährige. „Wenn jetzt ein großer Hund dabei wäre, würde Tara durchdrehen. Aber Tobi zeigt ihr, dass es nicht schlimm ist, wenn Hunde in ihrer Nähe sind und ich zeige ihr, dass Menschen sie nicht zwangsläufig bedrängen. Dadurch, dass ich einfach nur da bin, ohne sie zu beachten, entspannt sie sich langsam wieder.“ Ob die Hündin je soweit sein wird, dass sie bei einer Familie einziehen kann, weiß ihre Therapeutin nicht.
Die Arbeit mit Angsthunden ist kleinteilig und langwierig
Besonders die Arbeit mit Angsthunden ist kleinteilig und langwierig, erklärt sie. Eine unbedachte Bewegung oder ein verfrühter Therapie-Schritt, kann die Fortschritte von Wochen zunichte machen. Für Tara hat Doris Urban extra den Welpen aus Ungarn adoptiert. „Es gibt kein Pauschal-Rezept. Jeder Hund ist anders und bei Tara hatte ich den Eindruck, dass ein Welpe bei der Arbeit helfen könnte“, sagt sie. Tobi soll nun ein paar Wochen bleiben, ehe er in ein langfristiges Zuhause vermittelt wird.
So ruhig wie in diesen Momenten mit Tara geht es im Haus sonst nur selten zu. Die alte Villa mit dem Türmchen namens „Lotta im Glück“ beherbergt nicht nur ihre Besitzerin, sondern aktuell zehn Hunde. „Ich hätte nie gedacht, dass das mal so groß wird. Am Anfang hatte ich nur vereinzelt Pflegehunde und inzwischen habe ich schon 160 in ganz Deutschland und der Schweiz vermittelt“, erinnert sie sich. Neben Ihrem Vollzeitjob als Shuttlefahrerin im Bremerhavener Hafen, füllt die Aufnahme, Resozialisierung und Vermittlung von Hunden und Katzen ihre komplette Freizeit aus.
Eigentlich war Doris Urban immer ein Katzen-Mensch, doch als sie sich im Alter von 20 Jahren mit ihrem damaligen Partner den ersten Hund aus dem Tierheim holte, nahm ihr Leben eine entscheidende Wendung. Ab diesem Zeitpunkt entdeckte sie nicht nur allgemein ihre Liebe zu den Vierbeinern, sondern insbesondere zu Huskys. Immer mehr Schlittenhunde zogen bei ihr ein, bis sie sich schließlich von 2007 bis 2012 nach Finnland ging, um dort in einem Schlittenhund-Camp für Touristen zu arbeiten. „Von den Huskys habe ich eigentlich alles gelernt, was ich über Hunde weiß – einfach nur dadurch, dass ich sie beobachtet habe „, sagt sie. Das enge, natürliche Zusammenleben mit dem Rudel prägt ihre ehrenamtliche Arbeit für „Born to live“, einem Verein für Auslandstierschutz, bis heute.
Einige Hunde sind nicht vermittelbar
Als Doris Urban die Hintertür zum 2,5 Hektar großen Gelände öffnet und einmal kurz pfeift, ist es mit der Ruhe vorbei. Acht Hund stürmen durch die Tür ins Warme, wedeln wild mit den Schwänzen, buhlen um die Aufmerksamkeit ihrer Retterin. Im Gegensatz zu Tara sind bei ihnen keine Anzeichen einer Traumatisierung zu erahnen. Und doch wird nicht jeder dieser Hunde bei einer Familie einziehen können. Insbesondere Hunde aus Rumänien, die auf der Straße geborgen wurden und nie ein familiäres Leben kennengelernt haben, sind oft nicht vermittelbar, weiß die Hunderetterin.
Tierschützer es kritisch sehen, wenn Straßenhunde nach Deutschland geholt werden. Die Zahl der Hunde in deutschen Haushalten steigt seit Jahren kontinuierlich an. Von 2013 auf 2018 ist sie, laut einer Heimtierstudie der Universität Göttingen, von 6,8 Millionen auf 9,4 Millionen (also mehr als 38 Prozent) gestiegen. Doch zugleich landeten bereits 2012 rund 80.000 Hunde jährlich in deutschen Tierheimen. Auch hier ist die Tendenz steigend. Doch es sind nicht nur die unbedachten Welpenkäufer die ihre Tiere abgeben, sondern auch Menschen, die sich einen Hund aus dem Ausland geholt haben, ohne zu wissen, welche Schwierigkeiten das mit sich bringen kann.
„Vor allem die Straßenhunde aus Rumänien kommen hier mit unserer Lebensweise oft nicht klar“, erklärt Urban. „Welpen lernen schnell, dass sich Menschen irgendwie anders verhalten und passen sich an. Aber ein Straßenhund kann auf unbekanntes Verhalten von Menschen aggressiv oder extrem ängstlich reagieren. Für sie ist es eine Drohgebärde wenn man ihnen direkt in die Augen guckt oder frontal auf sie zugeht“, fährt sie fort.

Doris Urban nimmt über „Born to live“, einem Verein für Auslandstierschutz, ungarische Hunde bei sich auf, die ansonsten getötet werden würden. In Deutschland sollen sie an neue Besitzer weiter vermittelt werden. Damit beide Seiten gucken können, ob die Harmonie stimmt, dürfen die Hunde bei potenziellen Familien Probewohnen. Foto: Arnd Hartmann
Hunde suchen ein Zuhause
In Ungarn gibt es im Gegensatz zu Rumänien kaum Hunde, die auf der Straße aufwachsen. Staatlich beauftragte Hundefänger, fangen die Tiere regelmäßig ein und bringen sie in eine Tötungsstation, ehe sie sich auf der Straße vermehren. „Die meisten ungarischen Hunde sind deshalb ehemalige Wachhunde, die auf der Straße gelandet sind, weil die Besitzer zum Beispiel kein Geld für den Tierarzt hatten oder es sind ungeplante Welpen, die ausgesetzt wurden“, sagt sie.
Doch auch wenn ungarische Hunde den Kontakt zu Menschen meist früh kennengelernt hätten, seien sie nicht zwangsläufig einfach zu resozialisieren, betont Urban. Bei der Auswahl der Tiere versucht sie deshalb eine gute Mischung zu finden, zwischen Hunden, die einfach zu vermitteln sind und Hunden, denen sie selbst einen schönen Lebensabend auf ihrem weitläufigen Grundstück bescheren möchte.
Der übermütige Hütehund-Mischling namens Waldon
Ein brauner, strubbeliger Hütehund-Mischling namens Waldon, springt übermütig auf einen älteren Husky zu. Der zieht die Lefzen hoch – doch der Junghund lässt sich nicht beeindrucken. Zweiter Versuch: Jetzt wird der Husky ungehalten und maßregelt den aufdringlichen Vierbeiner mit deutlichem Bellen. Waldon bellt pampig zurück – ehe er sich verzieht. Situationen wie diese lässt Doris Urban einfach laufen. Sie kennt ihre Hunde und muss nur selten eingreifen, um ernsthafte Auseinandersetzungen zu verhindern.
„Hunde kommunizieren anders als wir, und das ist vielen Hundekäufern nicht wirklich bewusst. Kinder dürfen weinen oder schreien, aber ein Hund soll keinen Mucks von sich geben ...“, sie hält inne und lässt die Worte im Raum stehen. Auch bei ihr werden immer mal wieder Hunde nach einer Adoption zurückgegeben, weil das Zusammenleben nicht reibungslos funktioniert, erzählt sie.
Waldon hat gerade erst für mehrere Wochen bei einer Familie gelebt. Doch als er anfing sein neues Herrchen in die Fersen zu zwicken, musste er wieder gehen. „Natürlich geht das nicht, aber man sollte sich auch immer über die Rasse informieren, die man sich anschafft. Waldon ist ein Hütehund, die zwicken ihre Schafe, um sie anzutreiben“, sagt sie. „Wenn man solche Tiere körperlich sehr stark hochpuscht und sie nicht geistig auslastet, kann das passieren.“

Die Hunderetterin lebt auf einem 2,5 Hektar großen Gelände mit einem 4500 Quadratmeter großen, eingezäunten Bereich für Hunde. In enger Zusammenarbeit mit den Tierschutzeinrichtungen der Region, kümmert sie sich hier um die Resozialisierung von Auslandshunden. Foto: Arnd Hartmann
Urbans Grundidee: Hunde im Rudel leben lassen
Dennoch könne man Hütehunden derartiges Verhalten auch wieder abgewöhnen, indem man klare Grenzen setzt – so wie Hunde es untereinander auch tun würden. „Anders als in Ungarn, vermenschlichen wir Hunde in Deutschland und dadurch entstehen dann Probleme im Zusammenleben. Es ist kein Zufall, dass es in den letzten Jahren so viele Hundetrainer und Hundepsychologen gibt, wie nie zuvor. Meine Grundidee in der Hundearbeit ist es, die Tiere im Rudel leben zu lassen, damit sie nicht nur von uns Menschen, sondern auch voneinander lernen“, sagt sie und lässt die Finger über Tobis weiches Welpen-Fell gleiten.