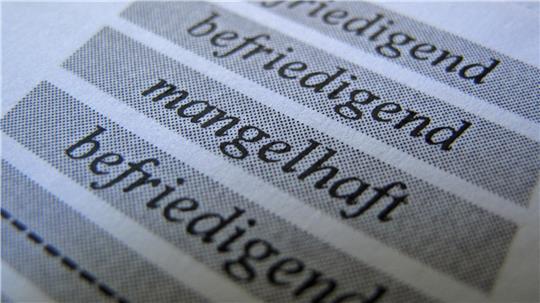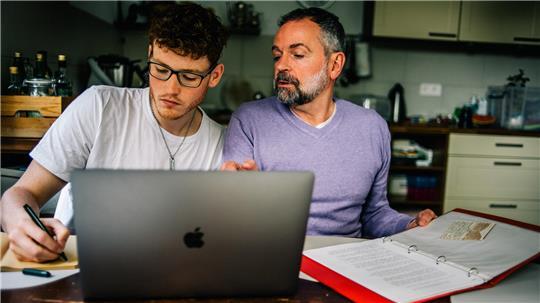TGeneration TikTok: Die permanente Erreichbarkeit und ihre Folgen

Die Generation Z kennt keine Welt ohne Social Media. Prof. Döveling warnt vor den Auswirkungen digitaler Kommunikation auf unser emotionales Wohlbefinden. Foto: Büttner/dpa
Social Media potenziert den Druck, perfekt zu sein, warnt Professorin Katrin Döveling. Im Interview gibt sie Einblicke in ein gewaltiges Menschenexperiment.
Landkreis. Katrin Döveling ist Professorin für Kommunikationswissenschaften an der Hochschule Darmstadt. Nach Studien in Psychologie, Soziologie und Medienwissenschaften erforscht sie derzeit, wie Menschen in digitalen Medien mit Emotionen umgehen. Dabei hat sie auch untersucht, wie sich der Social-Media Konsum auf das Selbstwertgefühl von jungen Frauen auswirkt und wie sich durch das digitale Leben unsere Emotionen verändern.
Im Interview verrät sie, wie sie mit den sozialen Medien umgeht und was sie tun würde, wenn sie Kultusministerin wäre.
Frau Döveling, nutzen Sie soziale Medien und wenn ja, wie häufig?
Selbstverständlich habe ich auch Social Media und ich nutze es tatsächlich oft mehr, als mir persönlich lieb ist. Es gibt auch bei mir Anzeichen, dass ich das Handy mal weglegen sollte.
Welche Anzeichen sind das?
Nervosität, das Gefühl mithalten zu wollen, immer erreichbar zu sein für Studierende, für Kollegen, für alle, permanent. Und diese permanente Erreichbarkeit stresst! Kürzlich habe ich auf meinem Handy eine Benachrichtigung erhalten, dass mein Fotospeicher voll ist – da bekam ich kurz Herzrasen. Ich mache, wie die meisten von uns, gern viele Fotos, aber früher ging es doch auch ohne.
Denken Sie, wir könnten jetzt auch noch ohne?
Ich glaube, wir alle können gar nicht mehr ohne Social Media. Ich bin mit Kollegen und Freunden vernetzt. Wir sind auf den permanenten Informationsfluss angewiesen und da befinden wir uns tatsächlich in einem „Fear of Missing Out“ (FOMO, die „Angst, etwas zu verpassen“). Wer sich nicht entsprechend verlinkt, gehört nicht mehr zum Dialog, zum Diskurs.
Ist Ihre Generation resilienter gegen die Einflüsse von Bildern auf Social Media?
Auch ich war schon verstört und irritiert von manchen Bildern. Aber ich versuche, mich nicht verführen zu lassen.
Inwiefern?
Immer weiter zu scrollen. Man lässt sich leicht verleiten, besonders bei Instagram, und merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Denn, gerade, wenn es um Schönheitsideale geht: Es sind retuschierte Trugbilder. Das darf man nicht vergessen. Und man sollte das Handy regelmäßig weglegen. Es tut nicht gut!
Sind Sie für eine Alterseinschränkung bei der Nutzung von Smartphones?
Ich plädiere für Aufklärung! Da sind wir alle gefragt. Wir alle sollten Vorbilder sein für die nächsten Generationen. Es geht darum, wann wir das Handy wie und in welchem Kontext nutzen. Es ist gut, wenn zum Beispiel Kinder Hilfe brauchen und ein Handy haben. Die Eltern wissen, wo das Kind ist und dass es erreichbar ist. Das hilft natürlich. Aber es sollte nicht unser Leben bestimmen und vor allem auch nicht das von Kindern. Raus in die Natur, mit Freunden Fußball oder andere Spiele spielen.
Das darf nicht abhandenkommen. Es ist grundlegend und essenziell für die Entwicklung von Kindern, dass sie ihre Sozialkompetenzen im Spiel mit anderen entwickeln, und das geschieht nicht durch das Daddeln auf einem omnipräsenten Handy.
Computer Bild
Over-Ear-Kopfhörer im Test: Vier Modelle sind „sehr gut“
Welchen Umgang braucht es damit?
Wir können die sozialen Medien nicht wegradieren. Es ist wichtig, dass wir lernen, dass diese Bilder stilisiert sind. Es sollte in den Schulen in den Unterricht integriert werden. Wenn ich Kultusministerin wäre, würde ich das Fach Medienkompetenz in der Schule verankern.
Wie könnte das aussehen?
Es geht nicht darum, dass Handys ohne Grund und ohne einen Diskurs mit Kindern und Jugendlichen weggesperrt werden sollen. Aber es ist wichtig, zu lernen, das Handy auch mal freiwillig beiseitezulegen. Handys sollten zweckgerichtet eingesetzt werden.
Was bedeutet das für die Praxis?
Es geht nicht nur darum, zu erlernen, wie man ein Gerät bedient. Es geht auch darum, wie man mit dem Gerät, sich und anderen verantwortungsvoll umgeht. Dass man sich überlegt, was macht es mit mir und mit anderen.
Sprechen Sie auch mit Ihren Studierenden darüber?
Ich mache ein Experiment mit Ihnen. Ich frage sie, wie lange sie in den letzten Tagen online waren. Das kann man auf den meisten Smartphones nachsehen. Das regt zum Nachdenken an.
Und dann?
Dann möchte ich, dass sie sich fragen, was es ihnen gebracht hat, so lange online zu sein. Welchen Nutzen hatte ich davon? Oft ist es nur Langeweile. Der Sog der sozialen Medien.
Womit würden Sie es vergleichen?
Mit einem Sog, einem Magnet, der uns in den Bann zieht. Es hat körperliche und psychische Effekte auf Menschen. Das Stresshormonlevel steigt. Das kann man auch sehr gut an sich selbst beobachten, wenn man mal das Handy vergessen hat oder es kaputt ist.
Meinen Sie, es liegt daran, dass Handys mittlerweile auch mehr sind als nur Handys? Viele führen auch ihren Kalender darüber, machen Fotos...
Handys sind mittlerweile digitale Identitätsmanager geworden – und Emotionsregulatoren.
Was müsste über die Schule hinaus passieren, damit Kinder einen Umgang mit dem Smartphone erlernen?
Auch Eltern sollten sich mit ihren Kindern mehr darüber unterhalten. Wir definieren uns darüber, wie andere uns wahrnehmen, und das ist auch normal. Aber bei all den gefilterten Bildern, die aufgehübscht sind, kann es zu einer wirklichen Belastung führen.

Professorin Döveling ist gegen eine allgemeine Altersbeschränkung bei Smartphone. Sie würde das Fach Medienkomeptenz in der Schule verankern. Foto: Murat/dpa
Jede Generation hat ihre Aufreger – in den 1920er-Jahren wurde das Radio gefürchtet, in den 50er-Jahren der Fernseher. Verhält es sich mit den sozialen Medien ähnlich?
Als der Fernseher in den 50er-Jahren in unsere Haushalte kam, hat man es auch mit Aufklärung versucht, da man Angst hatte, dass er die Wahrnehmung verzerrt. Man hat gemeinsam ferngesehen. Eltern wissen heute jedoch kaum, was ihre Kinder konsumieren.
Wozu würden Sie raten?
Auch hier bin ich wieder beim Thema Medienkompetenz. Dieses Thema braucht mehr Aufmerksamkeit. Eltern sollten abends mit ihren Kindern über diese Themen sprechen, aber auch Schulen und Lehrer sollten es häufiger aufgreifen.
Wir erleben gerade eine Rückkehr zu toxischen Schönheitsidealen. Multiplizieren sich diese schneller über die sozialen Medien, als es in den 2000er über Magazine der Fall war?
Ich glaube, es potenziert sich sogar. Ich sehe diese Entwicklung bedenklich. Wenn gerade junge Menschen, die sehr oft konsumieren, diese Bilder sehen, verspüren sie einen Druck, mitzuhalten.
Sehen Sie aktuell direkte Auswirkungen, die es auf Jugendliche haben kann?
Zahlen zeigen beispielsweise, dass sich immer Jüngere einer plastischen Operation unterziehen oder mit Botox behandeln lassen. Wir sollten von diesem permanenten Schönheitswahn wegkommen und Schönheit auch über Herzenswärme, Freundschaften und andere innere Werte definieren.
Was würden Sie sich für die nachwachsenden Generationen wünschen, die selbstverständlich mit den sozialen Medien aufwachsen?
Einen bewussteren Umgang – erst überlegen, bevor sie etwas posten. Aber auch, dass sich wahre Freunde nicht immer nur bei Social Media tummeln, sondern im tatsächlichen Leben – mit denen man Pizza essen geht. Es braucht aber auch mehr Sensibilität beim Schreiben von E-Mails.
Erleben Sie das selbst häufig in Ihrem Alltag oder auf der Arbeit?
Ich habe festgestellt, dass Studierende oft mal schnell eine E-Mail schreiben. Montags habe ich häufig hunderte Mails, bevor ich in den Tag starte.
Was macht das mit Ihnen?
Das kann krank machen. Die permanente Erreichbarkeit und das permanente Antworten führt zu Stress. Der Mensch ist noch nicht dafür gemacht, dauerhaft zu kommunizieren. Wir befinden uns also alle in einem großen Menschenexperiment.