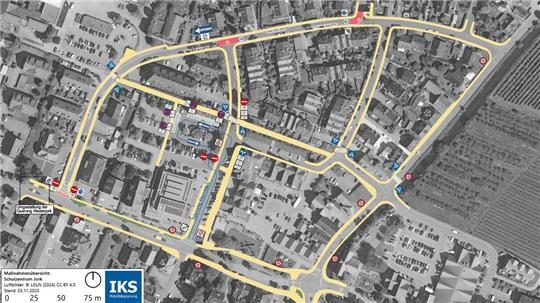TNS-Richter schicken fünf Altländer Schlachter ins Zuchthaus

Blick in das Stader Landgerichtsgefängnis. Foto: Quelle
Der 8. Mai 1945 war für die Verfolgten des Nationalsozialismus im Kreis Stade ein Tag der Befreiung. Viele waren im Landgerichtsgefängnis Stade misshandelt worden. Doch nicht jedes Opfer wurde nach dem Krieg entschädigt.
Estebrügge. Das Landgerichtsgefängnis Stade war „ein zentraler Ort der Repression und des Unrechts“, sagt der Experte für die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten im Landkreis Stade, Michael Quelle. Gewalt war an der Tagesordnung.
Gestapo-Beamte schlugen mit dem Gummiknüppel „kräftig zu“
Mitten in Stade wurden Menschen verhört, gefoltert, geschlagen und ins KZ gebracht. Bei Verhören schlugen Gestapo-Beamte und Justizwachtmeister mit dem Gummiknüppel „kräftig zu“, sagte das Stader NS-Opfer Johannes Hemmke nach dem Krieg aus.
Willkürliche Einweisungen - ohne Beteiligung der Justiz - durch die Gestapo nahmen bis 1945 stark zu, ebenso wie die „Polizeihaft“ durch Landrat und Geheime Staatspolizei (Gestapo).
Für 102 Zwangsarbeiter war Stade die erste Station auf dem Weg in den Tod
Die Zahlen sind erschreckend. Ein Beispiel: 102 Zwangsarbeiter starben nach der Unterbringung in Stade später in Konzentrations- oder Arbeitserziehungslagern sowie Zuchthäusern, oder wurden von der Gestapo ermordet.
Das Gefängnisbuch mit den Namen und Daten der Inhaftierten ist lückenlos erhalten geblieben. Viele Gerichtsakten hingegen vernichteten die Nazis kurz vor Kriegsende, anderen fielen den Bomben zum Opfer.
Trotzdem haben sich Dokumente erhalten - von den Verlegungen der Zwangsarbeiter in Konzentrationslager, aber auch über die Verfolgung von Deutschen. Wer alliierte Sender hörte („Rundfunkverbrechen“) oder heimlich schlachtete, musste mit Verfolgung und drastischen Strafen rechnen.
Feldpost unterschlagen - Staderin wird gehenkt
Verstöße gegen die Kriegswirtschaftsbestimmungen wurden auch im Kreis Stade „unerbittlich geahndet“, berichtet der Historiker Hartmut Lohmann. Die Versorgungslage war schlecht, der Lebensmittelbezug über die Marken reichte nicht aus.
Die Staderin Trinchen B. unterschlug deshalb Feldpostpäckchen. Sie wurde zum Tode verurteilt und gehenkt.
Estebrügge: Mehrere Schlachter landen hinter Gittern
Auch im Alten Land, unter anderem in Estebrügge, kam es zu Verhaftungen. Fünf Altländer Schlachter landeten ab August 1941 hinter Gittern - erst in Stade, später in Hannover. Ihr Vergehen: Sie hatten schwarz geschlachtet und das Lebendgewicht des Schlachtviehs reduziert, um für sich (und ihre Kunden) etwas abzuzweigen. In den Familien wird vermutet, dass ein Konkurrent sie angeschwärzt hat.
Der Landrat ließ ihre Schlachtereien „sofort“ schließen. NS-Richter verurteilten die Schlachter wegen der Kriegswirtschaftsverbrechen zu zwei Jahren Zuchthaus, außerdem wurden die „Parteigenossen“ aus der NSDAP ausgeschlossen und verloren ihre bürgerlichen Ehrenrechte.Zeitgeschichte
T Wie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte
Die Schlachtungen mussten vom Ortsbauernführer genehmigt werden. Doch der Viehbestand hatte sich während des Zweiten Weltkriegs reduziert. 1944 gab es noch 26.000 Schweine im Kreis Stade. Zum Vergleich: 1936 zählte die amtliche Statistik noch 88.500 Stück.
Schweine und Rinder hatten wegen des Futtermangels wenig auf den Rippen. Im Alten Land gab es seinerzeit viele fleischverarbeitende Betriebe und Schweinemäster; Obst und Getreide, Viehzucht und Meerrettich-Anbau dominierten den Agrarsektor in der Marsch.
Verbotene Liebe: Stader Arbeiterinnen werden verurteilt
Auch der verbotene Umgang mit Kriegsgefangenen/Zwangsarbeitern wurde hart bestraft. Rechtliche Grundlage war eine Verordnung von 1939 - für militärische Sicherheit und nationalsozialistische Rassenideologie.
Fünf Arbeiterinnen der Stader Saline landeten deshalb im Zuchthaus. Das Sondergericht verurteilte sie am 10. Dezember 1942 „wegen des verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“, sie mussten bis zu zwei Jahre ins Zuchthaus. Ihnen war ein intimes Verhältnis mit einem Franzosen vorgeworfen worden.
Entschädigung für Saline-Arbeiterinnen wird nach Kriegsende abgelehnt
Nach dem Krieg beantragten sie eine Entschädigung für Haft und Verdienstausfall von 20 Mark wöchentlich. Doch die Entschädigungsbehörden lehnten das im Jahr 1954 ab.
Die Richter stuften die Frauen nicht als politisch Verfolgte ein. Sie hätten sich nicht gegen den Nationalsozialismus gestellt, außerdem seien sie nicht wegen ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauungen durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden. Laut Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung hätten sie deshalb keinerlei Ansprüche.„Zwangsarbeitern ging es sehr gut“: Baljerin ins KZ gesteckt
Die Willkür regierte. Die 27 Jahre alte Auguste Jarks aus Balje starb am 27. Mai 1945 auf dem Rückweg vom KZ Ravensbrück an Entkräftung. Sie war bezichtigt worden, ein Verhältnis zu einem Polen zu haben.
Die Polizei, die der Denunziant einschaltete, konnte das nicht bestätigen, weshalb ihr kein Prozess gemacht wurde. Die Geheime Staatspolizei nahm sie trotzdem in Haft.
Die Gestapo steckte sie ins Konzentrationslager, weil es laut einiger Nazis „den Zwangsarbeitern auf ihrem Hof sehr gut ging“.
Keine Entschädigung für Opfer des NS-Unrechts
Die Behörden und die Justiz der jungen Bundesrepublik, viele Richter waren Mitglied der NSDAP gewesen, wiesen nach der Befreiung und der Gründung der Bundesrepublik viele Entschädigungsanträge zurück - insbesondere bei Menschen, die wegen „Rundfunkverbrechen“ oder „Wehrkraftzersetzung“ verurteilt worden waren und zum Teil mehrere Jahre hinter Gittern saßen.
Ein Beispiel ist der Landarbeiter Heinrich B. aus Krummendeich. Er saß 1944/1945 im Landgerichtsgefängnis ein. Er hatte gesagt, „dass Deutschland gegen den Feind nicht mehr an könne“. Perfide: Der Sonderhilfsausschuss vertrat 1953 die Ansicht, dass die Äußerung bereits in eine Zeit gefallen sei, in der der Krieg allgemein als verloren galt. Deshalb sei die Äußerung kein Ausdruck des Widerstands gegen den Nationalsozialismus gewesen.
Der 8. Mai war für die Verfolgten ein Tag der Befreiung, sagt Quelle, doch das „Unrecht wurde nicht immer geheilt“. So sei es wichtig, dass an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werde. Auch er hat heute Blumen an den Mahnmalen, Stelen und Gräbern niedergelegt.