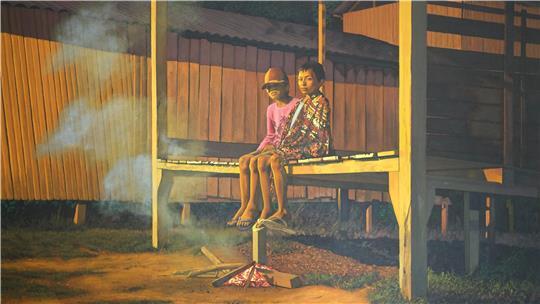TBestseller-Autorin Kristine Bilkau: „Gen Z ist nicht faul, sondern ziemlich fleißig“

Auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet: Autorin Kristine Bilkau. Foto: Thorsten Kirves
Kristine Bilkau hat für ihren neuen Roman „Halbinsel“ den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Im Zentrum: ein Mutter-Tochter-Duo und die Annäherung zwischen zwei Generationen.
Hamburg. Der Rahmen der Erzählung: Nach deren Zusammenbruch holt Annett ihre Tochter Linn zu sich nach Hause. In Nordfriesland soll die Mittzwanzigerin neue Energie finden, doch die junge Frau sieht in ihrem alten Leben keinen Sinn mehr...
TAGEBLATT: Frau Bilkau, handelt Ihr Roman „Halbinsel“ gleichermaßen von einem Mutter-Tochter- und einem Generationskonflikt?
Kristine Bilkau: Absolut. Annett ist mit verschiedenen Krisen groß geworden, die in ihrer Familie überwiegend mit finanziellen Engpässen zu tun hatten. Dementsprechend denkt sie sehr viel über Sicherheit nach. Sie verkennt allerdings, dass ihre Tochter ganz andere Lebensfragen beschäftigen. Linn möchte vor allem eins: Aufrichtigkeit. An ihrem Ringen darum erschöpft sie sich.
Dabei hat Linn eigentlich mal voller Elan studiert und sich enthusiastisch in ihren Beruf gestürzt. Ist sie letztlich am Kapitalismus gescheitert?
Linn ist so eine Art Superperformerin mit hohen Ansprüchen an sich selbst gewesen. Und sie wollte sich schnell sinnvoll einbringen: Wie sieht es in der Welt aus? Wo gibt es Probleme? Was kann ich tun? Mit großem Idealismus hat sie sich in Schweden und Rumänien an Aufforstungsprojekten beteiligt. Nach ihrem Umweltmanagementstudium fand sie einen Job bei einer Holding, dort hat sie Umweltprojekte für den freiwilligen Emissionshandel betreut. Mit der Zeit musste Linn jedoch erkennen: Diese Geschäftsmodelle sind nicht so nachhaltig, wie nach außen hin kommuniziert wird.
Weil der freiwillige Emissionshandel lediglich ein Ablasshandel ist?
Nicht nur, aber zu einem großen Teil. Firmen und Investmentfonds finanzieren Waldbau oder kaufen riesige Waldgebiete, um damit CO₂-Zertifikate zu verdienen. Zertifikate, mit denen Unternehmen den Ausstoß ihrer Treibhausgase kleinrechnen. Doch wie sinnvoll ist dieses System? Was wird da wirklich geschützt? Der Planet oder die Geschäftsmodelle der Unternehmen? Man weiß doch nicht, wie viel Kohlendioxid ein Wald in den nächsten 10 bis 40 Jahren tatsächlich absorbieren wird. Trotzdem werden auf Basis theoretischer Annahmen Zertifikate vergeben. Das Ganze ist wie ein Bild für uns Menschen. Der freiwillige Emissionshandel ist ein komplexes Konstrukt mit dem Zweck, wirtschaftlich möglichst wenig verändern zu müssen und die Augen vor unbequemen Wahrheiten zu verschließen.
Solche Missstände prangert gerade Gen Z an, die wiederum von älteren Leuten oft kritisch beurteilt wird. Sind junge Menschen wirklich so schlecht wie ihr Ruf?
Es kursieren viele Klischees. Gen Z will nicht mehr arbeiten, heißt es ganz pauschal. Die Jungen denken nur über Work-Life-Balance und Mental Health nach. Ich frage mich: Warum muss es negativ gesehen werden, wenn eine Generation kritisch auf die Arbeitswelt blickt und sich um ein intaktes Sozialleben kümmern möchte?
Gen Z wird also Ihrer Ansicht nach unterschätzt?
Kürzlich las ich in einer Studie, dass 20- und 25-Jährige, oft Studierende, noch nie so viel gearbeitet haben wie heute. Sie müssen jobben, weil es keine gut bezahlbaren WG-Zimmer oder kleine Wohnungen mehr gibt. Sprich: Sie sind nicht faul, sondern ziemlich fleißig.
Trotz der angeblichen Überbehütung und Hypersensibilität?
Man muss sich vor Augen führen, wie diese jungen Menschen aufgewachsen sind. Da ist der menschenverachtende Trump-Diskurs aus den USA, den wir seit 2016 kennen. Rechtspopulisten gefährden auch in Europa die Demokratie. Eine weitere Belastung war die Pandemie. Es gab Home Schooling für Kinder, Studierende saßen allein zu Hause vor ihren Bildschirmen. Diese Generation hat wahnsinnig viel zurückstecken müssen und dennoch durchgehalten. 2022 kam noch der Krieg in der Ukraine dazu. Und über allem schwebt die Klimakrise. Mit so belastenden Themen zu jonglieren und dennoch seinen Platz in der Welt zu finden, das ist eine Herausforderung. Wir sollten mit großem Respekt von Gen Z und den noch Jüngeren sprechen, statt sie abzuwerten.
Damit tut sich Ihre Protagonistin Annett schwer. Sie kann nicht akzeptieren, dass ihre Tochter plötzlich in einer Bäckerei arbeitet.
Ja, insgeheim hatte sie da andere Erwartungen. Aber auch die Perspektive der Mutter ist auf eine Weise nachvollziehbar. Annett hat einen Kredit aufgenommen, um ihrer Tochter das Studium zu ermöglichen. Ihr Credo war immer: Mein Kind soll es besser haben als ich selbst. Ein ganz verständlicher Wunsch, der viele Eltern antreibt.
Kann er junge Menschen unter Druck setzen?
Ich denke schon. In Annetts Generation finde ich mich selber wieder. Wir wollen uns in der Kindererziehung von dem abgrenzen, was unsere Großeltern und zum Teil noch unsere Eltern ertragen mussten. Sie waren während der Kriegs- oder Nachkriegszeit mit sozialer Härte und emotionaler Kälte konfrontiert. Damals galt: „Stell dich nicht so an!“ Im Gegensatz dazu schaffen wir Geborgenheit und Wärme. Unsere Kinder sollen sich frei entfalten können. Trotzdem können wir uns nicht völlig vom gesellschaftlichen Leistungsdruck und Selbstoptimierung freimachen. Unterschwellig haben wir wahnsinnige Angst vorm Scheitern.
Zumindest in einer Szene scheint sich Ihre Figur Annett davon zu lösen, wenn sie am Dockkoog in Husum schwimmen geht.
Annett hat früh ihren Mann verloren und ist allein für ihre Tochter verantwortlich, sie lebt mit diesem starken Gefühl: Mir darf nichts passieren. Darum schwimmt sie nur gern zusammen mit anderen. Dass sie am Dockkoog doch allein ins Wasser geht und ihre Bahnen schwimmt, ist für sie eine Art Durchbruch, eine Befreiung.
Stimmt es, dass Sie ebenfalls eine leidenschaftliche Schwimmerin sind?
Ja. In Hamburg schwimme ich am liebsten im Freibad. Auch wenn es nieselt und grau ist. Eine besondere Teenager-Erinnerung verbindet mich mit dem Bad Marienhöhe in Blankenese. An den Wochenenden im Sommer sind wir dort nachts eingestiegen und geschwommen. Es war so dunkel, dass man die anderen nur schemenhaft erkennen konnte. Ansonsten schwimme ich gern in der Ostsee, auch die Nordsee hat viele tolle Stellen zum Schwimmen.
Stichwort Nordsee: Warum spielt Ihr Roman eigentlich in Nordfriesland?
Mir ging es um die Küstennähe. Am Lebensraum Küste kristallisiert sich das Verhältnis von Mensch und Natur sehr stark heraus. Entlang des Wassers lassen sich Geschichten von Verletzbarkeit und Widerstandskraft erzählen. Die Nordsee ist mir sehr vertraut. Mein Vater stammt aus Dithmarschen und ist einige Jahre zur See gefahren, meine Mutter, meine Großeltern und auch meine Urgroßeltern kommen von der Nordsee.
Wie haben Sie sich diesem Landstrich angenähert? Haben Sie dort intensiv recherchiert?
Ich habe schon als Kind viel Zeit an der Nordsee verbracht, durch meine Familie. Irgendwann dachte ich: Ich möchte mich genauer damit auseinandersetzen. Ich bin oft in Nordfriesland, für meinen Roman habe ich zum Beispiel zu ganz unterschiedlichen Jahreszeiten Wattwanderungen gemacht. Das Wattenmeer sieht immer wieder anders aus, das ist faszinierend.
Harriet von Waldenfels
T Werden Moderatorinnen weniger ernst genommen als Männer?
Was hat Sie dabei besonders interessiert?
Bei meinen Romanfiguren geht es unter anderem um den Umgang mit der Geschichte, speziell mit der versunkenen Stadt Rungholt. Sowohl Annett als auch Linn haben sich in der Schule mit dem Gedicht von Detlev von Liliencron über die große Sturmflut beschäftigt – jede mit ihrer eigenen Wahrnehmung. Für die Mutter sind das Verse aus der Vergangenheit, die Tochter dagegen denkt bei dieser Flutkatastrophe an die Zukunft.
Aufgrund des Meeresspiegelanstiegs könnten sogar Teile Hamburgs überflutet werden, noch lässt es sich in Eimsbüttel aber gut leben. Was mögen Sie an diesem Viertel?
Wenn ich aus dem Haus komme, bin ich sofort mitten im Geschehen und habe Menschen um mich herum. Zugleich hat sich Eimsbüttel einen gewissen Dorfcharakter bewahrt, man kennt die Leute und die Läden. Wobei die Gentrifizierung auch hier fortschreitet. Es ist immer ein Verlust, wenn ein alteingesessenes Geschäft geschlossen wird.
Zur Person
Kristine Bilkau wurde 1974 in Hamburg geboren, aufgewachsen ist sie in Wedel. Nach dem Abitur studierte sie Geschichte und Amerikanistik – teils in Hamburg, teils in New Orleans. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Journalistin. 2015 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Die Glücklichen“, der mehrere Preise bekam. Ihr Roman „Nebenan“ stand 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Am 2. April, 19.30 Uhr, liest sie aus ihrem neuen Roman „Halbinsel“ im Literaturhaus Hamburg. Am 29. April, 19.30 Uhr, gibt es eine Lesung im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel.
Auch in ihrem aktuellen Roman benennt die Autorin nicht den eigentlichen Handlungsort. Er könnte auf Nordstrand oder Eiderstedt liegen, einige Szenen spielen in Husum. Diese Stadt mag die Hamburgerin ebenso wie Flensburg oder Schleswig. Obwohl sie gern mit ihrer Familie in Eimsbüttel wohnt, übt das ländliche Schleswig-Holstein auf sie eine große Anziehungskraft aus.
Persönlich
Mein erstes Buch war... Astrid Lindgrens „Lotta zieht um“.
Mein Lieblingsroman ist... „Die Wand“ von Marlen Haushofer.
Schreiben bedeutet für mich... mich mit der Welt auseinanderzusetzen und alles, was ich wahrnehme, zu verarbeiten.
Wenn ich in einen Buchladen gehe..., fühle ich Vorfreude und Glück.
Am meisten fasziniert mich an der Leipziger Buchmesse... dass es so viele schöne Begegnungen gibt und wirklich die Literatur im Fokus steht.
Im Urlaub lese ich am liebsten... alle Romane, die sich bei mir aufgestapelt haben.