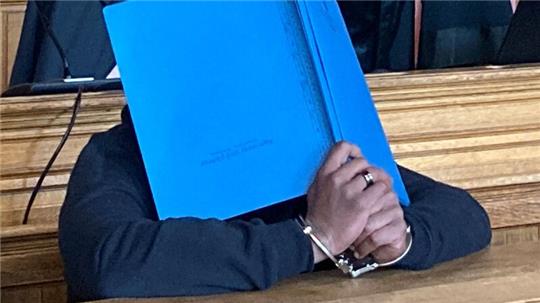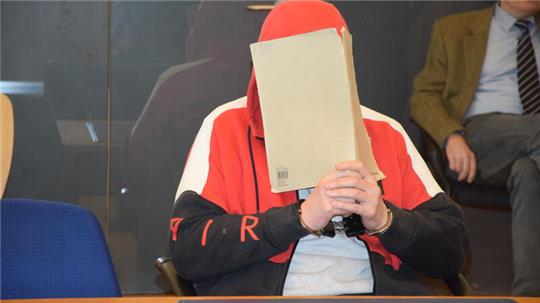TKriminalpsychologe: In diesen Fällen kann jeder zum Mörder werden

Geplant oder im Affekt: In gewissen Situationen sind Menschen zu schwersten Gewalttaten fähig. Foto: Micha Klootwijk
Merten Neumann analysiert das Verhalten von Verbrechern. Der Kriminalpsychologe erklärt, warum mehr Männer als Frauen kriminell werden, was Verbrechen wahrscheinlich macht und was Menschen antreibt, andere zu töten.
TAGEBLATT: Glauben Sie an das Gute im Menschen?
Merten Neumann: Ja, aber auch an das Böse. Der Mensch hat ein massives Potenzial, etwas Gutes zu tun. Allerdings gibt es auch ein großes Potenzial, anderen Menschen Leid zuzufügen. Wobei die Einteilung in „böse“ und „gut“, „kriminell“ und „nicht-kriminell“ grundsätzlich schwierig ist. Nicht jedes straffällig-relevante Verhalten ist moralisch verwerflich. Aber auch nicht alle Verhaltensweisen, die nicht strafbar sind, sind moralisch gut.
Wie wird man denn kriminell?
Kriminalität ist in der Regel ein konkretes Verhalten und entsteht, weil sich eine Person mit einer individuellen Persönlichkeitsstruktur in einer spezifischen Situation dafür entscheidet. In dieser Persönlichkeitsstruktur können Aspekte enthalten sein, die eine Entscheidung für Kriminalität wahrscheinlicher machen: zum Beispiel so etwas wie Impulsivität oder Aggressivität. Die Persönlichkeit eines Menschen formt sich immer durch komplexe Wechselwirkungen zwischen genetischer Anlage und äußeren Einflüssen. Es ist aber natürlich auch ausschlaggebend, in welcher Situation man sich aktuell befindet: Alkohol- oder Drogenkonsum etwa können die Hemmschwelle senken. In konkreten Situationen können auch äußere Reize kriminelles Verhalten auslösen – etwa wenn man von jemandem provoziert oder beleidigt wird. Klar ist: Kriminalität findet nicht im luftleeren Raum statt; auch Inhaftierte sind nicht 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche aggressiv oder kriminell.
Kann jeder zum Kriminellen oder sogar Mörder werden?
Prinzipiell schon, denn unter extremen Umständen kann praktisch jeder zu einem kriminellen Verhalten bewegt werden. In Kriegs- oder akuten Bedrohungssituationen sind die allermeisten Menschen zu schwersten Gewalttaten fähig. Das gilt auch, wenn sie erheblich provoziert werden oder in andere Ausnahmesituationen geraten, die sich möglicherweise über Jahre aufbauen. Denken Sie zum Beispiel an Gewalttaten innerhalb einer Familie. In solchen Fällen kann es beispielsweise dazu kommen, dass ein Mensch als Folge jahrelanger Erniedrigung, Unterdrückung oder Misshandlung irgendwann bereit und in der Lage ist, einem anderen das Leben zu nehmen.

Merten Neumann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN). Foto: privat
Ist es gefährlich, wenn man mitunter, etwa bei einem Streit, „Ich bringe ihn um“ denke?
Grundsätzlich haben Einstellungen und Gedanken nur bedingt etwas mit dem eigenen Verhalten zu tun. Es gibt viele Kontrollmechanismen, die dazu führen, dass wir nicht jeden Impuls, der uns gerade in den Kopf schießt, umsetzen. Bei manchen Menschen ist diese Kontrolle besser ausgeprägt, bei anderen weniger gut. Es ist auf jeden Fall nicht untypisch, dass man Gedanken hat, die einem als normabweichend oder gruselig erscheinen – aber deshalb wird man zum Beispiel nicht sofort zum Mörder.
Was treibt Menschen an, andere zu töten?
Es gibt „klassische“ emotionale Motive, die zum Beispiel auch in der Kriminal-Literatur häufig behandelt werden – Delikte aus Eifersucht, Wut, Rache, Habgier. Aber es gibt auch Tötungsdelikte, die aus Symptomen einer psychischen Erkrankung entspringen oder die mit sexuellen Präferenzstörungen zusammenhängen. Dann wieder gibt es Tötungsdelikte, die in einem extremen Kontext stattfinden: etwa Tötung auf Befehl in einer Kriegssituation. Meistens sind die Motive sehr individuell und komplex – und es kommen mehrere Aspekte zusammen. Es gibt auch Fälle, in denen Menschen Probleme mit dem Empathie-Empfinden haben: Bei Menschen mit psychopathischem Persönlichkeitsmuster etwa fehlen Kontrollmechanismen, die normalerweise dazu führen, dass solche Handlungen nicht ausgeführt werden.
Reden wir in diesen Fällen von Serientätern?
Nicht unbedingt. Probleme mit diesen Kontrollmechanismen können dazu führen, dass Personen häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sind aber in aller Regel nicht die Serien schwerer Gewalttaten, die man es sich unter den medial geprägten Begriffen Serientäter oder Serienmörder vorstellt. Diese Art von Tätern gibt es gar nicht so häufig, wie man denkt. Daher ist es schwer, Systematiken zu finden. Eine ungünstige Kombination aus sadistischen Neigungen (also einer Art Freude daran, anderen Leuten Schaden oder Leid zuzufügen) - und psychopathischen Persönlichkeitsmerkmalen (etwa fehlendem Empathie-Empfinden und Impulskontrollprobleme) kann aber zu wiederholten Gewalttaten führen, insbesondere wenn diese sexuell konnotiert sind.
Werden Frauen seltener kriminell als Männer?
Definitiv! Die Unterschiede sind immens, gerade im Bereich von Gewaltstraftaten und Sexualstraftaten. Im Bereich Sexualstraftaten sind 98 Prozent der Tatverdächtigen in den polizeilichen Statistiken Männer, bei Gewaltstraftaten sind es ungefähr 90. Bei der Gesamtkriminalität sind ungefähr Dreiviertel der Tatverdächtigen männlich.
Woran liegt das?
Die Gründe dafür sind komplex. Neuropsychologische Unterschiede spielen dabei eine Rolle, aber auch Sozialisierung und Erziehung.
Was bedeutet das konkret?
Bei Männern und Frauen gibt es zum Beispiel Unterschiede beim Hormonhaushalt und bei der Ausformung der Hirnareale, die etwas mit regelübertretendem Verhalten zu tun haben. Das alles wird meist aber nur wirksam in Interaktion mit Sozialisierungsbedingungen, also vor allem auch der Erziehung. Grundsätzlich werden an Mädchen und Jungen unterschiedliche Rollenbilder herangetragen werden. Bei Jungen heißt es häufig „du musst mutig sein“, „du musst stark sein“, „du musst deine Ehre“ verteidigen. So entsteht häufig ein Verhalten, das mit Gewalt und Aggression assoziiert wird. Man spricht hier auch von Normen „toxischer Männlichkeit“.
Mädchen werden behüteter erzogen und ihre Aktivitäten werden von den Eltern stärker überwacht. Ein gewisses Maß von Grenzerkundungen und -überschreitungen gehört zum Erwachsenwerden dazu. Aber wenn ich weiß, was mein Kind tut, dann kann ich darauf reagieren – und es von gewissen Handlungen abhalten. Das ist der Grundbaustein für eine effektive Erziehung.
Wie kann man kriminellen Taten vorbeugen?
Prävention kann man auf ganz verschiedenen Ebenen denken. Das umfasst beispielsweise umfasst gesellschaftliche, städtebauliche und individuelle Ansätze. Dazu gehören das Fördern des Vertrauens der Bürger in den Staat, die Bekämpfung von Armut und die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. Unterernährung oder falsche Ernährung etwa kann im Kindesalter dazu führen, dass bestimmte Entwicklungsprozess im Gehirn in Gang gesetzt werden, die zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass kriminelles Verhalten im Erwachsenenalter gezeigt wird.
Städtebauliche Maßnahmen, wie eine verbesserte Beleuchtung oder eine „wohnlichere“ Gestaltung, können bei der Prävention helfen. Denn an Orten, an denen es schön aussieht und an denen man sich gerne aufhält, zerstört man weniger gerne etwas.
Ein großes Thema ist Jugendkriminalität. Hier können präventive Angebote an Schulen helfen, die sich an alle Jugendlichen richten. Bei anderen Angeboten geht es darum, frühzeitig Person zu identifizieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie eine kriminelle Karriere starten und Hilfen anzubieten - im familiären Kontext etwa Erziehungshilfen.
Landgericht Stade
T Baggersee-Mord: Angeklagter will Stimmen von Außerirdischen gehört haben
Welche präventiven Angebote sind noch sinnvoll?
Rückfallprävention beinhaltet Straftäterbehandlung: In diesem Bereich gibt es manchmal Unstimmigkeiten, wie effektiv solche Angebote wirklich sind. Aber man weiß, dass insbesondere Therapieangebote aus dem kognitiv-behavioralen Bereich – das ist eine Art der Verhaltenstherapien – sehr wirksam sein können. Wichtig ist, dass das Angebot an das Leistungs- und das Risikoniveau angepasst ist. Einen Kleinstkriminellen muss ich nicht sechsmal in der Woche in Therapiegespräche stecken. Der Behandlungsbedarf muss individuell angepasst werden, dann kann man mit entsprechenden Angeboten durchaus etwas erreichen.