T 24 Millionen Euro: Das passiert in Stades neuem Wasserstoffzentrum
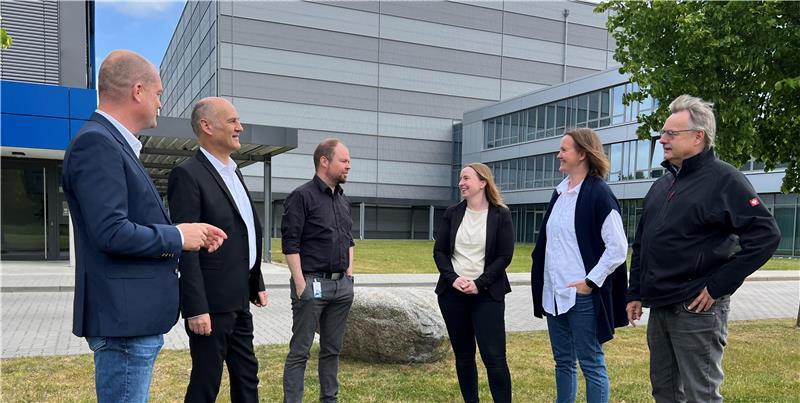
Füllen das neue Wasserstoff-Forschungszentrum beim CFK Nord in Ottenbeck mit Leben (von links): Carsten Schmidt, Dirk Niermann, Sven Torstrick-von der Lieth, Jenne Wendt, Saskia Deckenbach und Thomas Friedrichs. Foto: Strüning
In Stade-Ottenbeck entsteht ein neues Wasserstoff-Forschungszentrum von bundesweiter Bedeutung. An welcher Spezialität die Experten arbeiten.
Stade. Stade wurde im Zuge eines bundesweiten Ausschreibungsverfahrens auch deswegen ausgesucht, weil es im CFK-Nord in Ottenbeck bereits eine bestehende, integrativ agierende Forschung gibt. So arbeiten das Fraunhofer Institut, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die CFK-Forschungskooperation der Unis Hannover, Braunschweig und Clausthal seit Jahren eng zusammen, um Leichtbaustoffe für die Flugzeugfertigung weiter zu entwickeln. Das alles geschieht in enger Abstimmung mit Airbus und seinem Ableger CTC, das in direkter Nachbarschaft zum CFK-Forschungszentrum liegt.
Stade forscht an neuen Wasserstofftanks
Jetzt trifft CFK auf Wasserstoff. Eine neue Herausforderung für alle Beteiligten. Die Stader Spezialität: Es soll an Tanks für Wasserstoff geforscht werden, sowohl für die Luft- als auch für die Schifffahrt. Unis, DLR und Fraunhofer arbeiten bereits seit Jahren an dem Projekt. Jetzt gibt es durch die Bundesmittel, die durch die EU refinanziert werden, neuen Schwung und neue Möglichkeiten. Das Projekt läuft unter dem Titel H2AM (Hanseatic Hydrogen Center for Aviation and Maritime).
Zukunftstechnologie
T Für 24 Millionen Euro: Stade bekommt Zentrum für Wasserstoff-Forschung
Norddeutschland
Förderung von Wasserstoff-Tests für Luft- und Schifffahrt
23,8 Millionen will Berlin gen Stade überweisen. Insgesamt hat die Regierung dem Norden 72 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Summe teilt sich Stade als einzige niedersächsische Stadt mit Hamburg und Bremen/Bremerhaven. Gut neun Millionen Euro wird das neue Gebäude in direkter Nachbarschaft und in Ergänzung zum CFK-Nord kosten. Es wird betrieben von der Projektentwicklung (PE) Stade, einer Tochter der Stadt.
PE-Geschäftsführer ist Thomas Friedrichs. Seine Kollegin Jenne Wendt kümmert sich um die Ausstattung und die Abwicklung der Zuschüsse. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit Saskia Deckenbach von der Wirtschaftsförderung der Stadt Stade. Sie hat den Antrag zur Wasserstoffforschung initiiert und von Anfang an begleitet - mit großem Erfolg. Der ursprüngliche Antrag wurde Anfang 2021 gestellt. PE Stade vermietet die Halle an die einzelnen Forschungsinstitute.
Neue Forschungshalle mit Laboren und Vakuum-Bereich
Es entsteht eine neue, zehn Meter hohe Forschungshalle mit Laboren, Schwerlastkran, Druckluft, klimatisierten Bereichen und mobiler Absaugung. Arbeiten unter Vakuum wird möglich sein. Geboten werden auch Büroräume und ein „OpenLab“ zum Wissenstransfer für Schülerinnen und Schüler oder Studierende aus dem Mint-Bereich. Die neue Halle soll im ersten Quartal 2028 in Betrieb gehen. Noch wird die dafür aufwendige Ausschreibung zusammengestellt.
Die Leibniz Universität Hannover bekommt für ihren Dreier-Uni-Verbund 1,5 Millionen Euro. Dr. Carsten Schmidt vom Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen legt mit seinem Team die Grundlagen für die weitere Verarbeitung durch DLR und Fraunhofer. Sie testen die Materialien und Produktionsverfahren, die beim Bau von leichten Wasserstofftanks infrage kommen. Das geschieht im kleinen Maßstab.
Zukunftsjet
T Airbus plant neuen Flieger - mit klappbaren Flügeln
Flugzeugbauer
T Ziel gestrichen – Diese Airbus-Revolution muss warten
Chemie-Park
T Mega-Investition: Grüner Wasserstoff made in Stade
Nächster Schritt in der Stader Forschungskette ist das DLR, das die Entwicklungen der Universitäten in große, industrielle Formate umsetzt. Bisher geschah das in eher flachen Mustern für Flugzeugrümpfe oder Flügelstrukturen. Jetzt muss ein Tank entwickelt werden, der unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren muss. Er muss extrem leicht sein, damit das Flugzeug nicht zu schwer wird. Er muss möglichst viel Wasserstoff bei einer Temperatur von etwa minus 170 Grad Celsius lagern können. Und, ganz wichtig: Er muss einen extrem hohen Grad an Dichtigkeit aufweisen, damit möglichst kein Wasserstoff durch die Wände dringt.
Verarbeitung von CFK muss neu erfunden werden
Das heißt für das Team von Sven Torstrick-von der Lieth, das ein völlig neues System des Legeverfahrens mit der ultraleichten Kunststofffaser (CFK) für die Produktion des Tanks entwickelt werden muss. Vor allem die runden Enden - wie bei einem Überraschungsei - sind eine Herausforderung. Immer die spannende Frage: Hält das Material auch bei Hitze oder bei hoher Kälte?
Das gilt auch für die Kollegen des Fraunhofer Instituts, die die Ergebnisse vom DLR aufnehmen und für die Montage der einzelnen Teile zuständig sind. Dabei werden mehrere von der Flugzeugindustrie vorgegebene Modelle durchdekliniert. „Das Feld ist sehr weit offen“, sagt Dr. Dirk Niermann, Außenstellenleiter von Fraunhofer IFAM in Stade. Der größte Tank könnte einen Durchmesser von fünf und eine Länge von sechs Metern haben.
Logisch, dass der Treibstoff dann nicht mehr wie bisher in den Flügeln transportiert wird. Zumal in den Tragflächen der Wasserstoff nicht kalt genug gehalten werden kann. Also muss ein völlig neues Flugzeug entwickelt werden. Unter anderem Airbus ist dabei, um ein CO2-freies Fliegen zu ermöglichen. Der Tank wird seinen Platz wohl hinter den Passagieren im Rumpf des Fliegers finden. Fraunhofer erhält vom Bund 5,75 Millionen Euro, um den neuen Wasserstofftank unter dem Stichwort „CooLTank“ zu entwerfen und im Maßstab 1:1 zu erproben.
Dirk Niermann ist auch der Vorsitzende des neu gegründeten Vereins „Lightweight für Hydrogen Stade“. Hier finden sich alle wieder, die von den Bundeszuschüssen profitieren. Der Verein soll die Aktivitäten am Standort Stade koordinieren.
Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.















