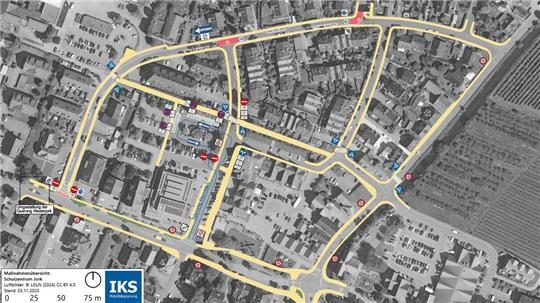TAltländer wollen deutschen Birnen-Markt erobern – dank Technik

Beim Feld- und Techniktag des Obstbauzentrums Esteburg wirbt Maike Steffens für die Ausweitung des Birnenanbaus. Foto: Vasel
Mehr Birnen und mehr Hightech: Die Obstbauern nehmen ihre Zukunft selbst in die Hand. Eine beliebte Apfelsorte ist allerdings eine Herausforderung.
Jork. Frühjahrsfröste sind nicht nur für den Obstbau eine Gefahr. Schließlich beginnt die Obstblüte im Alten Land immer früher. Seit 1976 hat sich der Blühbeginn um 27 Tage nach vorne geschoben. Doch die Altländer könnten auch vom Klimawandel profitieren.
Altländer Birnenanbau profitiert vom Klimawandel
Das hat Esteburg-Beraterin Maike Steffens beim Feld- und Techniktag des Obstbauzentrums Esteburg deutlich gemacht. Wegen des Klimawandels wird es im Norden wärmer. Das wirke sich positiv auf den Birnenanbau aus. „Birnen lassen sich leichter produzieren, der Anbau ist gut möglich“, sagte Steffens. Für Länder wie Italien hingegen wird es schwieriger. Sie roden ihre Birnenplantagen.

Im Alten Land stehen die Birnen auf Quitten. Andreas Hahn und Maike Steffens zeigen die Unterschiede bei der Wahl der Unterlagen. Foto: Vasel
Ein Risiko seien Schädlinge wie Birnenblattsauger oder Winterfröste. Schließlich stehen die Birnen im Alten Land auf frostempfindlichen Quitten. Diese schwach wachsenden Unterlagen sorgen dafür, dass die Birnen nicht in den Himmel schießen. Die produktiontechnische Zielgröße sind 3,50 Meter. Es gibt allerdings auch frostresistente Unterlagen bis minus 25 Grad.
Schädlinge wie der Birnenblattsauger werden auch mit Ohrenkneifern und Schlupfwespen bekämpft. Durch alternierendes Mulchen züchten sich die Obstbauern ein Nützlingsheer heran. Ohne biologischen und/oder chemischen Pflanzenschutz gehe es nicht. Kritisch sehen die Altländer, dass das Insektizid Movento auslaufen soll. Es gebe nämlich aktuell kein anderes wirksames Mittel mehr auf dem Markt.
Händler wünschen sich mehr deutsche Birnen
Birnen seien in den vergangenen sechs Jahren wieder in Fahrt gekommen. Im Handel gebe es einen Trend zu deutschen Birnen. Ihr Marktanteil hat sich laut Daten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) mit 13 Prozent seit 2017 fast verdoppelt, während die Italiener kräftig Federn ließen. 2023 kam nur noch jede zehnte Birne in deutschen Märkten aus Italien. Früher war es jede dritte. Vor allem die Niederländer und die Belgier sprangen in die Bresche.
Beim Zukunftsforum Obstbau hatten Fruchtgroßhändler wie Jürgen Faby und Marktexperten der AMI für die Ausweitung des Anbaus geworben. Ohnehin liege der Selbstversorgungsgrad bei Tafelbirnen in Deutschland laut Helwig Schwartau von der AMI bei lediglich knapp 20 Prozent. Es lohne sich: Erzeugerpreise seien um die Hälfte gestiegen.
Knapp ein Fünftel der deutschen Birnen-Gesamternte (2024: 38.000 Tonnen) stammen von der Niederelbe. Zur Einordnung: EU-weit wird in diesem Jahr mit einer Ernte von 1,79 Millionen Tonnen gerechnet.
Conference steht weiter hoch im Kurs
43.000 Birnenbäume wurden in der Saison 2022/2023 gepflanzt. Die Sorte Conference steht weiterhin auf Platz 1 - mit 20.000 Bäumen. Danach folgten die rotschalige Alessia sowie Alexander Lucas und Xenia. Rotschalige kommen bei den Neupflanzungen auf einen Anteil von knapp einem Drittel - Tendenz fallend. Aktuell liege der Flächenanteil der Birnen an der Niederelbe bei 2,6 Prozent. Der Apfel dominiert mit 90 Prozent. Die Kirsche liegt mit 4,3 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Birne und Pflaume (1,8 Prozent).

Auch V-Systeme werden auf der Esteburg erprobt. Foto: Vasel
Verschiedene Anbausysteme werden erprobt - von V-förmigen Bäumen bis zur Spindel. Für die Obstbauern hatte Steffens einige Tipps auf Lager. Die Birnen sollten nicht im Moor, sondern auf gutem Apfel- oder Kirschenland kultiviert werden. Kurzum: Die Birnen können zu einer lukrativen Nischenkultur werden, ist Steffens überzeugt.

Kernobstberater Jakob Turnsek gab einen Überblick über Apfel-Anbau-Systeme. Foto: Vasel
Der Fokus liegt weiter auf dem Apfelanbau. Auch hier war das Interesse groß - etwa an Gala-Sorten. Der Grund: Der Gala-Anteil im Einkaufswagen liegt bei 11,6 Prozent, an der Niederelbe lediglich bei 1,9 Prozent (Baumobsterhebung).

Madeleine Paap informiert die Obstbauern über die Viefalt der Gala-Sorten. Foto: Vasel
Der Handel wünscht sich mehr Früchte dieses Weltapfels. Doch der Anbau ist wegen der Krebs- und Schorfanfälligkeit herausfordernd.
Obstbauern setzen auf künstliche Intelligenz
Doch die Altländer haben nicht nur das Obst im Blick. Sie treiben die Digitalisierung voran. RGB-Kameras bestimmen Fruchtgrößen und -ausfärbung, während die Äpfel auf der Obsterntemaschine in der Kiste landen.

Hightech-RGB-Kameras können bereits die Fruchtgrößen zuverlässig messen; Carsten Köpcke gab einen Überblick auf der Obsterntemaschine Pluk-O-Trak. Foto: Vasel
Beim Techniktag präsentierte Moritz Hentzschel vom Obstbauzentrum Esteburg mit Benjamin Schulze und David Berschauer vom Fraunhofer Institut in Stade weitere Ergebnisse des Samson-Projektes. Samson steht für Smarte Automatisierungssysteme und -services für den Obstanbau an der Niederelbe.

Moritz Hentzschel vom Obstbauzentrum Esteburg gab einen Überblick zum Samson-Projekt. Foto: Vasel
In enger Zusammenarbeit mit der Hochschule 21 in Buxtehude sowie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und an der TU Hamburg entwickeln sie neue digitale Tools.

Blick auf die Sensorbox. Foto: Vasel
Ein Beispiel: Mit Hilfe der Kameras der Sensorenbox vor dem Schlepper wird die Blütenzahl bestimmt. Über die Ausdünnung kann so Fruchtertrag und -qualität gesteuert werden. Für einen Vollertrag müssen zwei Prozent der Blüten zu Äpfeln werden. Weitere Ansätze: KI-Systeme zur Detektion von Schädlingsbefall sollen einen noch gezielteren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ermöglichen, das gilt auch für die Wachstumsregulierung. Hentzschel: „Ob künstliche Intelligenz, autonomes Fahren oder Robotik, wir haben uns längst auf den Weg gemacht.“

Feste Station des Feld- und Techniktags auf der Esteburg ist die Apfel- und Birnenverkostung. Foto: Vasel