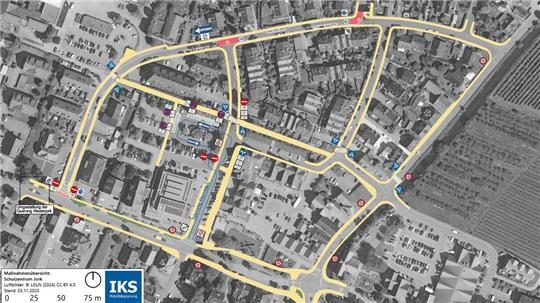TRefugialgewässer: Altländer baggern ihr neues Paradies

Die Wasser- und Bodenverbände haben mit dem NLWKN mehrere Refugialgewässer angelegt. Foto: Vasel
Im Alten Land entstehen neue Paradiese. Naturnahe Gewässer und schonende Grabenunterhaltung haben die Artenvielfalt weiter verbessert. Das sichert auch die Zukunft der 500 Obstbaubetriebe.
Altes Land. Auf Einladung des Unterhaltungsverbandes Altes Land hat Heike Braack vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in Stade (NLWKN) am Dienstag die Vertreter der Wasser- und Bodenverbände und des Obstbaus in Höfts Markthaus in Neukloster über den Sachstand bei den Refugialgewässern informiert. Warum ist das so wichtig? Sowohl der Einsatz chemischer als auch biologischer Pflanzenschutzmittel ist in der gewässerreichen Marsch mit hohen Auflagen verbunden.
Vorgeschichte: Seit 2015 gilt die Altes-Land-Pflanzenschutzverordnung (Alvo). Ohne diese Verordnung könnte aufgrund der Nähe zu den Gräben kein Obstbau mehr betrieben werden. Die unbefristete Alvo sichert die Existenz von knapp 500 Familienbetrieben an der Niederelbe. Mittlerweile reicht ein Abstand von fünf Metern, vorher waren 20 Meter zwischen Graben und erster Obstbaum-Reihe gefordert.
Obstbauern setzen bei Pflanzenschutz-Sprühgeräten auf abdriftmindernde Technik. Es gelten Mindestabstände zu den Gewässern. Hinzu kamen mehr naturnahe Beregnungsteiche, Hecken und Rückzugsgewässer. Damit ist das Eintragsrisiko auf ein Minimum reduziert worden. Die Betriebe überführen das 2000 Kilometer lange Gewässernetz in die Expositionsklasse eins oder zwei (Risikograd) bis Oktober 2025 - so wie gefordert.

Blick auf ein Refugialgewässer an der Hamburger Landesgrenze. Foto: Vasel
Doch nicht nur auf den Obstplantagen waren die Altländer gefordert. Um Restrisiken zu minimieren, forderte der Bund auch mit Blick auf die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL) mehr Anstrengungen. Diese verlangt bis 2027 das Erreichen „eines guten ökologischen Potenzials“. Allein durch betriebliche Maßnahmen sei das nicht zu erreichen. Deshalb hatten sich die Länder gegenüber dem Bund verpflichtet, Rückzugsräume vor allem für aquatische Lebewesen wie Muscheln, Schnecken, Krebse und Insekten wie Libellen zu schaffen. Fachleute sprechen von Refugialgewässern.
Sachstand: Bis zu zehn Prozent der Wasseroberfläche waren gefordert. Diese Gewässer mit Abstand zum Erwerbsobstbau haben eine „Rückzugs- und Reproduktionsfunktion, auch dienen sie der Wiederbesiedlung stärker belasteter Gebiete“, erklärte Heike Braack. Sie liegen unter anderem in der Nähe der Moorender Hauptwettern, an der Hollerner Binnenwettern und zwischen der Steinkirchener Moor- und Neuwettern. Mittlerweile seien 66 Prozent der geforderten Refugialgewässer geschaffen. 15 Hektar sind die Zielvorgabe.
NLWKN sucht Flächen für Refugialgewässer
„Wir brauchen mehr Flächen“, mahnte Braack. Knapp eine halbe Million Euro könne das Land im Jahr in die Schaffung der Rückzugsräume investieren. Mehrere größere teichähnliche Gewässer sind bereits angelegt worden. Doch auch ständig wasserführende Gräben, Wettern und Beregnungsteiche mit naturnah gestalteten Bermen (Flachwasserzonen) kommen in Frage. Sie appellierte an die Obstbauern, ihre Teiche zur Verfügung zu stellen.
Es winken Baukostenzuschüsse von 90 Prozent. In den Verträgen werde verankert, dass die Öko-Teiche weiter für Frostschutzberegnung und klimatisierende Beregnung genutzt werden dürfen. 1300 Beregnungsteiche gibt es. Es habe sich gezeigt, dass die Aufweitung von Wettern/Gräben für Flora und Fauna sinnvoller als der Bau von Riesen-Teichen sei. „Das bringt mehr, als teure Löcher in der Marsch zu graben“, so auch Verbandsvorsteher Hartmut Quast. Deshalb wird nun die Lange-Weg-Wettern im Verbandsgebiet Estemarsch ausgeweitet. Weitere Gräben, auch im Bullenbruch, sollen mit einem Monitoring auf ihre Eignung hin untersucht werden. Auch die Hollerner Moorwettern wird gemeldet, sie ist ohne großen Umbau bereits „ökologisch top-geeignet“.
Die Borsteler Binnenelbe ist vom Tisch. Mit dieser könnte das Gesamtziel auf einen Schlag erreicht werden. Doch das Land wünscht sich viele kleine, durch Gewässer verbundene Trittsteine. Stichwort: aquatische Durchlässigkeit.
Erfolge: Die Wasser- und Bodenverbände haben unter Federführung des NLWKN mit Obstbauern und Wissenschaftlern viel erreicht. Bereits seit 2016 läuft ein Modellprojekt zur schonenden Gewässerunterhaltung. Die Biologinnen Gabrielle Stiller, Friederike Eggers und Elisabeth Kliment beraten, forschen und schulen. Die Graben-Mahd erfolgt einseitig im Wechsel. Baggerbegleiter setzen Tiere aus dem Mähkorb/-gut zurück ins Gewässer. Auf den Modellstrecken „gab es keine Probleme bei Be- und Entwässerung“. Das ökologische Potenzial habe sich bei den Wasserpflanzen „überwiegend kräftig verbessert“ - von mäßig/unbefriedigend auf sehr gut und gut, so wie es die EU-Wasserrahmenrichtlinie fordert. Bei den Wirbellosen ist noch Luft nach oben, das Potenzial liegt überwiegend bei mäßig und gut. Rote-Liste-Arten wie Schlammpeitzger sind verbreitet. Stiller: „Das ist ein sehr schönes Ergebnis.“

Schonende Gewässerunterhaltung ist ein Beitrag zum Artenschutz. Foto: Klempow
Das fand auch der Vorsitzende der Fachgruppe Obstbau, Claus Schliecker. Ähnlich wie die Biodiversität-Studie des Bundesamts für Naturschutz, zeige das Projekt des NLKWN, dass Obstbau und Artenschutz kein Widerspruch seien.
Bundestagswahl
T Große Sorgen im Alten Land: So bedroht der Klimawandel den Obstbau
Verbandspolitischer Tag
T Obstbautage: Altländer hoffen auf eine neue Agrarpolitik in Berlin
Norddeutsche Obstbautage
T Darum werden diese Apfelsorten streng bewacht
Tag der offenen Tür
T Vom Deutschkurs bis zum Abi: Das alles bieten die Stader Berufsschulen
Weitere Themen
- Refugialgewässer
- NLWKN
- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
- Obstbau
- schonende Gewässerunterhaltung
- Artenschutz
- Wissenschaft
- Graben
- Mahd
- Wasser- und Bodenverbände
- Unterhaltungsverband
- Altes Land
- Alvo
- Altes-Land-Pflanzenschutzverordnung
- Pflanzenschutz
- Eintrag
- Restrisiko