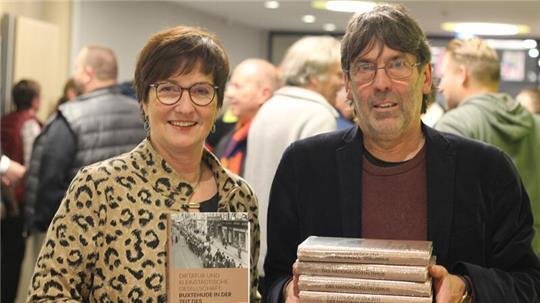TGedenken an NS-Opfer in Stade: Jetzt spricht die Politik ein Machtwort

Zivilgesellschaftliches Engagement: Die Omas gegen Rechts putzen in Stade am 9. November Stolpersteine und legen Rosen nieder - hier zum Gedenken an Diedrich Matthies. Foto: Richter
Es ist eine Ohrfeige für die Stader Stadtverwaltung: Der Kulturausschuss hat das vorgelegte Konzept des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus kassiert - und einen eigenen Vorschlag.
Stade. „Ich bin einfach enttäuscht. Das ist zu dünn“, sagte der Stader Ratsherr Robert Gahde (Grüne), selbst Archivar im Niedersächsischen Landesarchiv, über die vom Bürgermeister unterzeichnete Vorlage. Vor einem Jahr hatte der Kulturausschuss die Stadtverwaltung damit beauftragt, ein Gesamtkonzept zum angemessenen Gedenken an die NS-Opfer zu entwickeln. Was nun unter Federführung von Dr. Christina Deggim, Leiterin der Abteilung Archiv und Stadtgeschichte, im Kulturausschuss präsentiert wurde, enthalte aber „überwiegend Selbstverständlichkeiten und Gemeinplätze“.
Der Kulturausschuss sprach sich einstimmig und quer durch alle Fraktionen dafür aus, das Thema lieber selbst in die Hand zu nehmen. Er folgte damit einem Änderungsantrag der Grünen. Die Kritik war heftig: Für ein Gesamtkonzept, das diesen Namen verdiene, fehlten wesentliche Punkte, sagte Gahde.
Was im Konzept der Stadtverwaltung fehlt
Erstens: eine Bestandsaufnahme dessen, was an Gedenken und Erinnerungsarbeit in der Stadt bereits in Gang ist. Zweitens: eine Evaluierung der Gedenkstätten, Aktionen und Veranstaltungen. Drittens: ein Vorschlag, wie zivilgesellschaftliche Akteure einbezogen werden können. Es gibt nicht wenige, die in Stade aktiv sind: Schülerinnen und Schüler der BBS II beispielsweise, die einen antifaschistischen Audioguide entwickelt haben, der ebenfalls im Kulturausschuss vorgestellt wurde.
Mit ihren eigenen Stimmen und ihrer persönlichen Perspektive führen die jungen Leute per Audioguide zu Originalschauplätzen in der Stadt, erinnern an die Opfer und erzählen von nationalsozialistischer Gewalt und Unterdrückung. Dafür wurden sie 2024 von der Jury des Schülerfriedenspreises ausgezeichnet. Sie hoffen, dass die QR-Codes zum Audioguide, die bisher nur auf Flyern zu finden sind, in Zukunft auch an den Erinnerungsorten selbst angebracht werden. Darüber muss noch entschieden werden. Der Ausschuss signalisierte aber grundsätzlich Zustimmung.
Stades engagierte Bürger sollen einbezogen werden
Auch die Omas gegen Rechts, die in Stade am 9. November Stolpersteine putzen, gehören zu denen, die sich für eine lokale Erinnerungskultur engagieren. Ebenso wie Michael Quelle, lokaler Experte für die Erinnerung an die NS-Herrschaft und ihre Opfer. Oder Dr. Lars Hellwinkel, Lehrer am Athenaeum, der an der Gedenkstätte Sandbostel mit Schülerinnen und Schülern vor Ort arbeitet.

Künftig könnte hier ein QR-Code auf den Audioguide hinweisen, der erzählt, wie 1935 eine aufgehetzte Menschenmenge den Stader NS-Kritiker Pastor Johann Behrens über die Hohentorsbrücke jagte. Foto: Richter
Die Vorlage der Stadtverwaltung sah vor, dass der Beirat „Der Nationalsozialismus in Stade und seine Folgen“, zu dem Dr. Christina Deggim, Dr. Gudrun Fiedler, Dr. Thomas Bardelle und Prof. Dr. Dr. Rainer Hering gehören, die beratende Stelle für das Gesamtkonzept sein sollte. Doch das soll jetzt eine Arbeitsgruppe übernehmen. Je ein Mitglied jeder Fraktion oder Gruppe im Kulturausschuss soll dazugehören, außerdem der Bürgermeister, die Stadtarchivarin sowie Michael Quelle und Lars Hellwinkel.
Ein Punkt aus der Vorlage der Stadtverwaltung fand einhellige Zustimmung: Das Gedenken soll sich auf die eigene Stadtgeschichte fokussieren. Kritisiert wurde dagegen, dass die Stadtverwaltung den 2. Mai als künftigen Gedenktag zum Kriegsende gewählt hatte - den Tag der offiziellen Übergabe des Rathauses.
Wann war der Krieg in Stade zu Ende: am 1. Mai oder 2. Mai?
Lars Hellwinkel führt an, dass die britischen Einheiten selbst den 1. Mai 1945 als Tag der Besetzung Stades meldeten. Auch Dr. Anne Lena Meyer nennt in ihrer kürzlich präsentierten Dissertation den 1. Mai als Tag der friedlichen Übergabe der Stadt an die Briten. Sollte der Rat der Empfehlung des Kulturausschusses folgen, wird nun die neue Arbeitsgemeinschaft über Zeitpunkt und Konzept des Gedenkens beraten.
Zweiter Weltkrieg
T Kriegsende in den Dörfern vor 80 Jahren: Zerstörung und weiße Fahnen
80 Jahre Kriegsende
T NS-Opfer: Erinnerung an die getöteten Kinder von Fredenbeck
Um Gedenken ging es auch in der Bürgerfragestunde: Michael Quelle wollte wissen, weshalb ein Beschluss, den der Rat vor zweieinhalb Jahren gefasst hatte, noch immer nicht umgesetzt wurde: 71 Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und deren Kinder wurden ab 1943 bewusst nicht auf, sondern neben dem Camper Friedhof begraben - „verscharrt“, sagt Quelle. Heute ist das Areal Teil des Friedhofs. Dort sollte eine Erinnerungstafel aufgestellt werden, wie es sie auch auf dem Garnisonsfriedhof in Stade gibt. Solche Tafeln werden mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach einem bewährten Konzept erstellt, um über den geschichtlichen Kontext und die Opfer zu informieren.
Grund für die Verzögerung sei, dass Gedenktafeln dem Gesamtkonzept folgend in gleicher Weise an allen Orten aufgestellt werden sollten, erklärte Stadtrat Carsten Brokelmann. Die Camper Gedenktafel dürfte nun noch etwas warten müssen. Eine Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge will die neue Arbeitsgruppe aber in Erwägung ziehen.
Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.