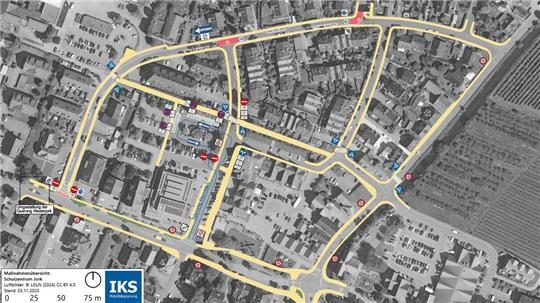TObstbauern setzen auf Ministerpräsident Stephan Weil und Samurai-Wespe

Bundestagskandidatin Frauke Langen, Claus Schliecker, Jens Stechmann und Landtagsabgeordnete Corinna Lange nehmen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in ihre Mitte (von links). Foto: Vasel
Die Obstbauern setzen auf Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) - unter anderem bei der Bekämpfung eines neuen Schädlings. Es drohen Millionenschäden an der Niederelbe.
Jork. „Das Deutschlandtempo in der biologischen Schädlingsbekämpfung ist ein Trauerspiel“, diese Botschaft gab Professor Dr. Roland Weber vom Obstbauzentrum Esteburg in Jork dem Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) mit auf den Weg nach Hannover. Der international anerkannte Pflanzenschutzexperte machte in seinem Vortrag deutlich, dass die ungefähr 500 Familienbetriebe an der Niederelbe von Folgen des Klimawandels bedroht sind. Von steigenden Temperaturen profitieren viele Schädlinge. In den vergangenen 50 Jahren ist die Jahresdurchschnittstemperatur um zwei Grad gestiegen. Apfelsorten wie Boskoop blühen 27 Tage früher. Ohne die Frostschutzberegnungsanlagen würden im Alten Land hohe Ernteausfälle drohen.

Marmorierte Baumwanzen auf einem Blatt. Foto: Weber/Esteburg
Der Ministerpräsident hörte sich die Sorgen und Nöte der Sprecher der Obstbauern und Wissenschaftler aufmerksam an. Der Bundesvorsitzende der Fachgruppe Obstbau, Jens Stechmann aus Jork, und der Landesvorsitzende Claus Schliecker aus Guderhandviertel, konnten ihre Forderungen bei Weil persönlich platzieren. Sie sollen jetzt Factsheets mit den Esteburg-Experten direkt an die Staatskanzlei schicken. Die Altländer und Kehdinger hoffen - nachdem die Gespräche mit der Niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) bei Pflanzenschutz, Nützlingsverordnung und Mehrgefahrenversicherung nicht fruchteten - nach der Weil-Visite auf mehr Unterstützung durch die Landesregierung. Die Landtagsabgeordnete Corinna Lange (SPD) hatte sich für den Besuch stark gemacht.
Altländer hoffen auf Hilfe bei Nützlingsverordnung
Die Obstbauern appellierten an Weil, sie bei der Einführung einer Nützlingsverordnung auf der Bundesebene zu unterstützen. Professor Weber verwies exemplarisch auf den Vormarsch der Marmorierten Baumwanze. Der 2004 nach Europa eingeschleppte Schädling aus Fernost ist mittlerweile auch im Alten Land auf dem Vormarsch. In Italien habe die Wanze im Jahr 2019 Schäden in Höhe von fast 500 Millionen Euro verursacht, sagte der Wissenschaftler. Ein Drittel der Ernte im Obst- und Weinbau wurden geschädigt, die Ware ist unverkäuflich.

Saugschäden durch eine Wanze am Apfel. Foto: Esteburg
Der Grund: Der toxische Speichel deformiert Äpfel und Birnen. Die Früchte können nicht mehr als Tafelobst vermarktet werden. Bei der Marmorierten Baumwanze helfen nur Insektizide mit starken Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Deshalb appellierten die Altländer an Weil, sie bei der Zulassung dieser Bio-Waffen zu unterstützen. In Italien und in der Schweiz werden zur Bekämpfung des Schädlings bereits Samurai-Wespen freigesetzt. Doch das ist hierzulande verboten, weil es keine Nützlingsverordnung gibt. Entsprechende EU-Regeln seien nicht umgesetzt worden.

Die Samuraiwespe krabbelt aus dem Wanzen-Ei. Foto: Zimmermann/LTZ Augustenberg
Für das Bundesamt für Naturschutz gilt die Wespe aus Ostasien wie die Wanze als invasive Art. Die Naturschützer in der Behörde lehnen Freisetzungen deshalb ab. Mittlerweile wurde die Samurai-Wespe allerdings bereits in Berlin gesichtet. „Diese ist kein Schädling, sondern ein Nützling“, unterstrich Weber. Der Eiparasit sei auf die Marmorierten fixiert. Parasitäre Samurai-Wespen legen ihre Eier in den Eiern der Baumwanzen ab. Ihre Larven schlagen sich mit der Wanzenbrut den Magen voll. In Italien sei die Strategie aufgegangen. Die Wanzengefahr konnte eingedämmt, Millionenschäden konnten durch gezielte Freisetzung vermieden werden. Und auch auf Chemie konnte verzichtet werden.
Obstbauern klagen über Wettbewerbsverzerrungen
Schliecker und Stechmann gaben Weil noch ihre Forderungen mit auf den Weg. Weils Aussagen zu einem Mindestlohn von 15 Euro statt 12,82 Euro pro Stunde bereitet ihnen Sorgen. Notwendig sei eine Extra-Lösung für die Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland, um weitere Arbeitskostensteigerungen zu vermeiden. Seit 2015 seien diese um 66 Prozent gestiegen. Damit nicht genug: Kosten für Pflanzenschutz und Energie hätten sich um bis zu 45 Prozent verteuert.
Obstbaubetriebe müssten von Steuern und Bürokratie entlastet werden, um die Nachteile steigender Lohnkosten im Wettbewerb mit Anbauregionen in Europa ausgleichen zu können. Erforderlich seien Investitionsförderungen, Erhalt der Agrardieselbeihilfe und steuerfreie Risikoausgleichsrücklage. Die Obstbauern beklagten, dass Ministerin Staudte ihre Branche vom Förderprogramm von Versicherungsprämien zum Schutz vor Wetterrisiken ausgeschlossen hat. Kollegen in Bayern oder Südtirol bekommen bis zu 65 Prozent der Kosten der Hagelversicherung vom Staat erstattet. Das sei ein erheblicher Wettbewerbsnachteil.
Beeindruckt zeigte sich Weil auch von der Angewandten Forschung für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Obstbau durch das Fraunhofer-Institut. Der Regierungschef sprach von einer riesigen Perspektive. Versprechungen machte er nicht. „Wir sind und wir wollen Agrarland Nr. 1 bleiben“, sagt Weil. Vielleicht kommt er 2026 zu den Obstbautagen. Die Einladung steht.

Obstbauern und Sozialdemokraten sowie Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts nehmen Ministerpräsident Stephan Weil im Schaufenster Obstbau der Esteburg in ihre Mitte. Foto: Vasel