Warum Onnos Kinder bald wieder Onnen mit Nachnamen heißen dürfen
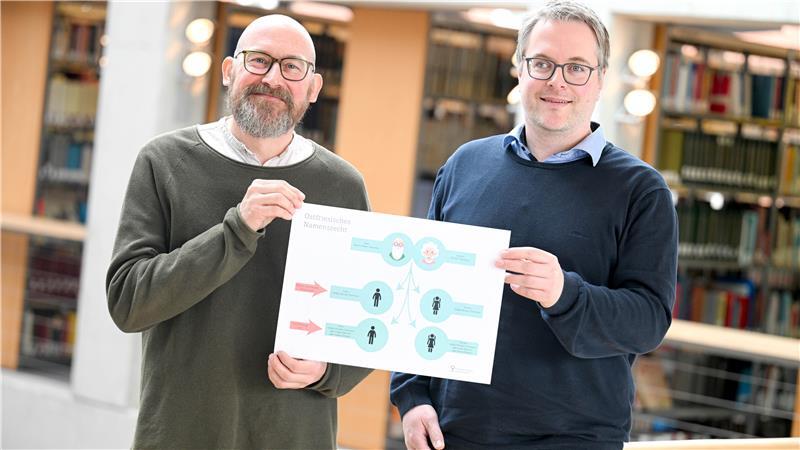
Sebastian Schatz (l) und Heiko Suhr stehen mit einem Plakat, das das neue ostfriesische Namensrecht erklärt, in der Bibliothek der Ostfriesischen Landschaft. Foto: Sina Schuldt/dpa
In Ostfriesland und Nordfriesland wurden Kinder lange nach dem Vornamen ihrer Väter genannt. Doch diese traditionelle friesische Namensgebung ist selten geworden – das könnte sich bald ändern.
Wer in Ost- oder Nordfriesland in Namensbüchern blättert, stößt auf wunderbar friesisch klingende Vornamen und Nachnamen: Onno Onnen, Peter Petersen oder Klaas Klaasen: Namens-Kombinationen, die für Fremde zunächst skurril scheinen mögen, sind tatsächlich ein Stück friesisches Kulturgut. Künftig ist es wieder erlaubt, solche friesischen Vornamen auch als Nachnamen weiterzugeben – möglich macht das eine vom Bundestag beschlossene Änderung beim Namensrecht, die zum 1. Mai in Kraft tritt.
Namen wie Onno Onnen gehen auf die sogenannte patronymische Namensgebung zurück, die in diesen Regionen Tradition hat. Patronym bedeutet so viel wie „der Name des Vaters“. Neu sei, dass durch die Gesetzesänderung auch die Vornamen der Mütter als Nachnamen an Töchter und Söhne weitergegeben werden können – also eine matronymische Namensgebung, erklärt Heiko Suhr, Leiter der Landschaftsbibliothek des Regionalverbandes Ostfriesische Landschaft im niedersächsischen Aurich.
Suhr ist Experte für friesische Namen. Natürlich müssen Vor- und Nachnamen nicht identisch sein. Er gibt ein anderes Beispiel für das neue Namensrecht: „Ich heiße Heiko mit Vornamen. Das heißt, ich könnte meine Tochter Heiken mit Nachnamen nennen. Oder nach dem Namen meiner Frau, Kirsten, dann Kirstens.“ Das Ergebnis sei jeweils ein völlig neuer Nachname.
Friesen sehen hohe Symbolwirkung
Dass diese Namensgebung überhaupt wieder möglich wird, dafür haben sich übergreifend viele friesische Verbände und Einrichtungen eingesetzt. Die friesische Volksgruppe zählt in Deutschland zu den nationalen Minderheiten. In Ostfriesland und in Nordfriesland heißt es, die Reform werde helfen, Tradition und regionale Identität zu bewahren.
Die größte Umgewöhnung werde wohl sein, dass man keinen festen Familiennamen mehr haben müsse. Man könne den friesischen Namen statt eines Nachnamens vergeben, sagt der Direktor des Nordfriisk Instituut in Bredstedt in Schleswig-Holstein, Christoph G. Schmidt. „Das war für uns ein entscheidender Punkt, weil das eine echte Anerkennung ist.“
Dass der Staat anerkenne, dass es in einigen Regionen ältere Traditionen gebe, habe eine sehr hohe Symbolwirkung, sagt Schmidt. Aus Sicht einer Gruppe wie den Friesen könne man kaum hoch genug einschätzen, dass man solche alten Rechtsgewohnheiten wieder anwenden dürfe.
Stefan Seidler, Bundestagsabgeordneter des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW), der Partei der dänischen und friesischen Minderheit, freut sich über die Neuregelung. Mit dem Gesetz bekämen die nationalen Minderheiten überall in Deutschland mehr Freiheiten, ihre eigenständige Identität ganz konkret zu leben. „Damit werden bisher scheinbar unüberwindbare bürokratische Hürden für unsere Minderheiten abgebaut.“
Was hinter der Tradition steckt
Für die meisten Menschen in Deutschland sei es wahrscheinlich utopisch, die eigenen Kinder so zu benennen, sagt Namens-Experte Suhr. „Das Wichtige ist, dass man Bekanntheit schafft, dass es diese Namenstradition gibt und, dass wir die Möglichkeit haben, es zu tun.“ In Ostfriesland habe die Namensgebung eine lange Tradition. „Dahinter steckt ein tiefverwurzeltes Heimatbewusstsein“, sagt Suhr. Auf diese Weise sei die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie deutlich gemacht und das Andenken an die Vorfahren in Ehre gehalten worden.
Als Ostfriesland 1744 preußisch wurde, wurde die patronymische Namensgebung durch feste Nachnamen abgelöst. In den 1870er Jahren ging die Namensgebung schließlich von den Kirchenbüchern auf die neuen Standesämter über und Familiennamen wurden vorgeschrieben. „Da war das friesische Namensrecht formell am Ende“, sagt Suhr.
Seit 1950 ist es Ostfriesen zumindest erlaubt, Patronyme wie einen zweiten Vornamen (offiziell Zwischenname) weiterzuführen. „Das ist das Privileg der Ostfriesen, gestattet mit ministeriellem Erlass aus Hannover“, sagt Suhr.
Mit dem neuen Namensrecht ändert sich auch das. Es gelte die vom Europarat garantierte Bekenntnisfreiheit nationaler Minderheiten. „Jede und jeder, die oder der sich als Ostfriese fühlt, kann dieses Gesetz für sich in Anspruch nehmen“, sagt Suhr. „Theoretisch könnte man das auch als Ur-Bayer.“
Nachfrage nach Beratung und Information
Übrigens können auch Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr einmalig selbst bestimmen und ihren Nachnamen, den sie bis dahin tragen, ablegen und einen neuen – entsprechend nach ihrem Vater oder ihrer Mutter – wählen.
Wegen des neuen Namensrechts verzeichneten Standesämter in Ostfriesland und Nordfriesland zuletzt zum Teil einen höheren Informationsbedarf. Allerdings gehe es dabei allgemein um neue Freiheiten in der Namensgebung und weniger um die friesische Namenstradition, teilen etwa die Städte Leer, Emden und Husum sowie die Gemeinde Sylt auf dpa-Anfrage mit.
Fragen dazu kämen auch bei der Ostfriesischen Landschaft an, sagt Namens-Experte Suhr. „Wir haben von vielen Menschen die Absicht gehört, sich umzubenennen und die uns ganz konkret gefragt haben: In welche Form geht denn das?“ Der Regionalverband hat deshalb eine Broschüre aufgelegt und nach eigenen Angaben Standesämter geschult. Auch in Nordfriesland wird es einen Leitfaden für Standesämter zu Aspekten des Namensrechts geben.
Nordfriesische Patronyme werden anders gebildet als in Ostfriesland
Gesetzmäßigkeiten, wie Patronyme oder Matronyme gebildet werden, gebe es nicht, wohl aber Gewohnheitsregeln, sagt Suhr. In Ostfriesland etwa werde ein Vorname, der auf einen Vokal ende, meistens durch ein „-en“ ersetzt. Also etwa vom Vornamen Haje zu Hajen, von Focko zu Focken. Aus dem weiblichen Vornamen Nele würde der Nachname Nelen entstehen. Vorschläge, wie Namen nach dieser Tradition aussehen könnten, gibt auch ein Namensgenerator auf der Website der Ostfriesischen Landschaft.
In Nordfriesland gibt es andere Formen. Die größte Stolperfalle sei wahrscheinlich erst einmal die Endung „-sen“, sagt Schmidt. „Die ist als solche, wenn sie mit „s“ beginnt, erst einmal nur für Söhne zulässig. Denn sie heißt Sohn. Eine Tochter hätte da nur ein „s“.“ Abgeleitet vom Vornamen Menno wäre Mennosen ein Sohn, Mennos eine Tochter. Das müssten dann erst einmal die Standesbeamten entscheiden, ob man Kinder unterschiedlich nennen dürfe, sagt Schmidt. „Das ist gesetzlich bisher nicht geregelt.“ Einfacher ist es mit Namen, die mit „s“ enden. Die Kinder eines Klaus würden alle sprachlich korrekt Klausen heißen können – egal, ob Sohn oder Tochter, wie Schmidt sagt.
Ob er mit vielen Anfragen und Komplikationen rechnet? „Ich glaube, es ist erst einmal ungewohnt“, sagt Schmidt. Es habe aber tatsächlich schon die erste Anfrage von einem Standesamt aus der Region gegeben, ob der Wunsch eines Elternpaares, seine Tochter auf bestimmt Weise zu benennen, denn sprachlich korrekt und zulässig sei. „Ich konnte das befürworten.“
Die befragten Standesämter erwarten kaum strittige Fälle oder einen erhöhten Vermittlungsbedarf – trotz der fehlenden Gesetzmäßigkeiten. Von der Stadt Leer heißt es etwa, generell gelte der plattdeutsche Rat: „Vorher mitnanner proten … helpt immer!“ („Vorher miteinander sprechen hilft immer!“)









