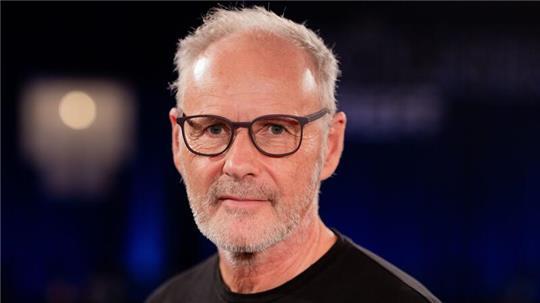20 Jahre Welterbe Bremen – Von einer geheimen Bar bis zur Schatzkammer

Das Bremer Rathaus am Marktplatz. Das Bremer Rathaus und die Rolandstatue von Anfang des 15. Jahrhunderts sind seit 20 Jahren UNESCO-Welterbe. Foto: Sina Schuldt/dpa
Chinesische Mauer, Akropolis - und das Rathaus und der Roland in Bremen: Die beiden Wahrzeichen der Hansestadt reihen sich seit 20 Jahren in die Unesco-Welterbeliste. Ein besonderer Rundgang zum Jubiläum.
Bremen. Für ein Foto mit den Bremer Stadtmusikanten drängeln sich Touristen aus aller Welt, dabei ist die eigentliche Attraktion im Hintergrund: Das Bremer Rathaus und die Rolandstatue von Anfang des 15. Jahrhunderts sind seit 20 Jahren Unesco-Welterbe. Zum Jubiläum ein Rundgang mit 20 Besonderheiten:
1. Das köstliche Fundament des Rathauses
Das Bremer Rathaus thront auf einem riesigen Weinkeller. In dem Gewölbe befindet sich das weltweit größte Sortiment ausschließlich deutscher Weine.

Die Schatzkammer des Weinkelles im Bremer Rathaus. Foto: Sina Schuldt/dpa
„Hier ist Platz für 1,2 Millionen Liter Wein“, berichtet Ratskellermeister Frederik Janus. Zumindest theoretisch, heute lagern noch mehrere 100 000 Flaschen Wein im Ratskeller.
2. Ein unmoralisches Angebot
Im schummrigen Kerzenlicht ist der älteste deutsche Fasswein im Bremer Ratskeller aufgebahrt. Der „Rosewein“ wurde 1653 in Rüdesheim am Rhein gekeltert. Und wie schmeckt der Tropfen heute? „Das weiß ich nicht, ich habe noch nicht probiert“, sagt Janus.

Der Eingang zur Schatzkammer des Weinkellers im Bremer Rathaus. Foto: Sina Schuldt/dpa
Als Ratskellermeister ist er der Einzige, der in den Genuss kommt. Ein Urlauber bot Bremen vor einigen Jahren 125 000 Euro für eine Flasche von dem Weißwein - ein verlockendes Angebot für die klamme Stadt, aber keine Chance.
3. Bremer Exklave an der Mosel
Die steife Brise in der Hansestadt ist nicht gerade ideal für den Weinanbau, trotzdem bewirtschaftet der Ratskeller einen eigenen Weinberg.
Das „Erdener Treppchen“ liegt zugegebenermaßen 500 Kilometer südlich an der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz. Dort wachsen die Trauben für den Bremer Senatswein, bei der Weinlese hilft traditionell ein Mitglied der Regierung mit.
4. Das Schiffchen klingelt
Wenn im Rathaus das Sammelschiffchen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) klingelt, mangelt es im Bremer Senat an Disziplin.
„Wer sein Handy vor der Senatssitzung nicht lautlos gestellt hat, muss für die Seenotrettung ins Schiffchen zahlen“, sagt Peter Lohmann, Bremer Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit. Auch für unzumutbar dicke oder verspätete Tischvorlagen sei eine Spende fällig.
5. Der kleine Unterschied
Immer dienstags tagt der Bremer Senat im Bremer Rathaus. Erst auf den zweiten Blick erkennt man den Unterschied zwischen dem Sessel für Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) und den Sesseln für die Senatorinnen und Senatoren: Die Rückenlehne des Bürgermeisters ist einige Zentimeter höher und seine Armlehnen sind mit Leder gepolstert.
6. Der Schlüssel zur Schatzkammer
Nur der Regierungschef und der Ratskellermeister haben Zugang zur Schatzkammer. Der Schlüssel ist unscheinbar, ganz im Gegensatz zum Schatz: unzählige in Folie eingewickelte Flaschen Trockenbeerenauslese und Beerenauslese, sehr süße Weine aus verschrumpelten Rosinen. Wegen des hohen Zuckergehalts sind die Flaschen lange haltbar. „Diese Weine machen auch nach hundert Jahren noch Spaß“, meint Janus.
7. Ein teures Vergnügen
Gleich links in der Schatzkammer lagert die älteste frei verkäufliche Flasche Wein: der „Rüdesheimer Apostelwein“ von 1727.

Die älteste frei verkäufliche Flasche Wein, der «Rüdesheimer Apostelwein» von 1727, lagert in der Schatzkammer des Weinkellers im Bremer Rathaus. Foto: Sina Schuldt/dpa
„Man trinkt davon nicht ein Glas zum Genießen oder gegen den Durst“, erklärt Janus. Schon ein Schluck sei sehr intensiv, der Geschmack lege sich über die Zunge. „Das ist ein irres Erlebnis.“ Die wenigen Flaschen verwaltet der Ratskellermeister selbst, eine koste 3000 Euro.
8. Die versteckte Turmbar
Der ehemalige Hausmeister hat in seiner Turmbar wohl eher Pils und Korn ausgeschenkt. Der kleine Turm gehörte zu seiner Wohnung im dritten Stock des Rathauses und ist noch immer eingerichtet wie ein Partykeller der 70er Jahre: ein Holztresen mit mehreren Barhockern, die Wände tapeziert mit Segelschiffen und Stickern von Werder Bremen, der Boden klebrig vom Alkohol und in der Luft abgestandener Rauch.

In einem der Türme des Bremer Rathauses hat ein ehemaliger Hausmeister eine versteckte Turmbar eingerichtet. Foto: Sina Schuldt/dpa
Seit dem Auszug des Hausmeisters vor 20 Jahren ist die Bar ungenutzt.
9. Flagge zeigen
Bis heute muss der Hausmeister morgens mit der Hand drei waagrechte Masten vom Dachboden herauskurbeln, an denen die Flaggen vor dem Rathaus wehen. „Der Wind weht oft so stark, dass der Hausmeister die Flaggen mehrmals am Tag wieder ein- und ausfahren muss“, sagt Peter Lohmann. Wenn die drei Meter breiten und fünf Meter langen Flaggen nass geworden sind, werden die Tropfen in einer Wanne auf dem Dachboden aufgefangen.
10. Eine Geheimtreppe
In dem mehr als 600 Jahre alten Rathaus gibt es einige Geheimwege wie die steile Treppe, über die der Ratskellermeister von seinem Büro direkt hinter dem Delphinfass ins Restaurant des Ratskellers gelangt.

Das Delfinfass, ein Prunkfass aus dem 18. Jahrhundert, steht im Restaurant des Ratskellers. Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Abkürzung war vor allem früher praktisch: Jeder Mitarbeiter habe täglich drei Liter Wein umsonst bekommen, erzählt Janus. „Heute gibt es kein festes Deputat mehr. Dafür darf ich jeden Wein probieren.“
11. Séparée mit Briefkasten
In einem Séparée des Ratskellers konnten Gäste einst direkt ihre Post abschicken. Auf dem Briefkasten aus Holz ist in verschnörkelter, goldfarbener Schrift zu lesen: „Leerung 3 mal täglich“. „Im Lokal wurden früher Postkarten verkauft, die konnten dann gleich verschickt werden“, berichtet der Ratskellermeister.
12. Tipp für die Nachwelt
Den Festsaal des Neuen Rathauses ziert ein Gemälde des Worpsweder Malers Carl Vinnen.

Im Rathaus hängt ein Gemälde des Worpsweder Malers Carl Vinnen mit einer kaum sichtbaren Notiz des Künstlers am Bildrand, mit der er sich an nachfolgende Generationen wendet: «Dieses Bild ist in Tempera, willst Du es ruinieren, empfiehlt es sich wohl, mit Öl zu restaurieren ...». Foto: Sina Schuldt/dpa
Kurios ist eine Notiz des Künstlers am Bildrand, mit der er sich an nachfolgende Generationen wendet: „Dieses Bild ist in Tempera, willst Du es ruinieren, empfiehlt es sich wohl, mit Öl zu restaurieren...“
13. Goldig
In der Güldenkammer des Rathauses geraten die Geldsorgen Bremens in Vergessenheit.

Die Güldenkammer des Bremer Rathauses mit vergoldeter Ledertapete aus der Renaissance-Zeit, gestaltet 1905 vom Worpsweder Künstler Heinrich Vogeler. Foto: Sina Schuldt/dpa
Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Zimmer im reinen Jugendstil, die Wände schmückt eine vergoldete Ledertapete aus der Renaissance-Zeit. Das Dekor und die glänzende Innenausstattung hat der Worpsweder Künstler Heinrich Vogeler 1905 entworfen. In dem Prunkstück des Rathauses werden hohe Gäste empfangen.
14. Schiffsmodelle mit Kanonen
Vier prächtige Schiffsmodelle hängen von der Decke der Obereren Rathaushalle.

Modelle von Kriegsschiffen hängen in der Oberen Rathaushalle vom Bremer Rathaus. Foto: Sina Schuldt/dpa
Zu Ehren besonderer Gäste wurden von den Kanonen der Schiffsmodelle Salut gefeuert. „Diese Kuriosität wurde im letzten Jahrhundert aus Sicherheitsgründen endgültig eingestellt“, sagt Lohmann.
15. Das älteste Freundschaftsmahl
In der Oberen Rathaushalle findet mit der Schaffermahlzeit das älteste jährliche Freundschaftsmahl der Welt statt. Jeder Gast darf nur einmal in seinem Leben mitfeiern. Rund 300 Menschen sind zu der Zeremonie geladen, die fünf Stunden dauert und minutiös geplant ist: vom Servieren der sechs Gänge über das Halten von zwölf Reden bis hin zum Sammeln der Spenden für die Stiftung Haus Seefahrt, die Seeleute und Nautik-Studierende unterstützt.
16. Hanseatisches Understatement zwischen Klo und Küche
Am 2. Juli 2004 gab das Welterbekomitee in der chinesischen Stadt Suzhou bekannt, dass Bremen Welterbe wird. Die begehrte Unesco-Urkunde hängt seitdem an einer Wand im ersten Stock - zwischen den Eingängen zur Damentoilette und der Küche im Rathaus. „Bremische Hanseaten protzen nicht, man gibt sich bescheiden, Reichtümer und Besonderheiten werden eher nicht ins Schaufenster gestellt“, meint Peter Lohmann.
17. Die Schwierigkeit mit dem Welterbe
Welterbe verpflichtet - zum Erhalt und zur Information über die Welterbestätte. Bremen tut sich damit schwer, auch nach 20 Jahren gibt es noch keine Ausstellung über das Rathaus und den steinernen Roland. 2026 soll es so weit sein, dann soll in der Unteren Rathaushalle ein Welterbe-Besucher- und Informationszentrum öffnen.
18. Papstkreuz im Hintern
An der Renaissance-Fassade des Rathauses sind kunstvolle Reliefs zu bewundern. Besonders spektakulär: Eine kniende Figur mit einem Papstkreuz im nackten Hintern, auf ihr reitet eine ebenfalls nackte Frau mit Reichsapfel und Löwe. Die Szene spiele auf den Triumph der weltlichen Macht über die kirchliche Macht an, erklärt Birgitt Rambalski, Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Welterbes Rathaus und Roland in Bremen.
19. Bremer Freiheitsstatue
Der Bremer Roland wacht seit 1404 über die Freiheit und Rechte Bremens. „Er ist die Freiheitsstatue Bremens“, sagt Peter Lohmann.

Die Rolandstatue auf dem Marktplatz. Das Bremer Rathaus und die Rolandstatue von Anfang des 15. Jahrhunderts sind seit 20 Jahren UNESCO-Welterbe. Foto: Sina Schuldt/dpa
Mit einer Höhe von mehr als zehn Metern ist der Ritter auf dem Marktplatz die größte frei stehende Statue des deutschen Mittelalters - und noch dazu eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt.
20. Ein missbrauchtes Versteck
Nationalsozialisten sollen den Roland im Jahr 1938 als Versteck für Dokumente missbraucht haben. Sie sollen eine Kassette mit Lobpreisungen auf Adolf Hitler und die Ideologie eingemauert haben, berichtet Stadtforscher Andreas Calic. Handwerker hätten bei einer Restauration 1984 die Schatulle entdeckt, selbst eine Botschaft über die Millionen Todesopfer des Regimes geschrieben und alles wieder in einer Karstadt-Tüte im Roland versteckt. Vier Jahre später sei die Kassette offiziell geborgen worden, die Dokumente lägen mittlerweile im Staatsarchiv.