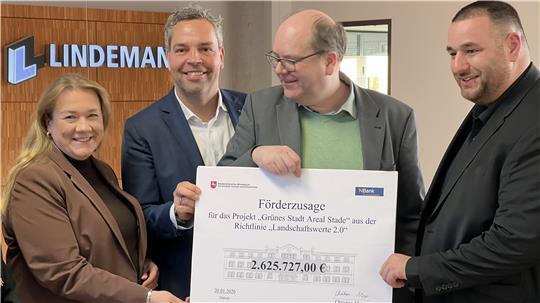Die ausgeklügelten Sangeskünste der Vogelmännchen

Rotkehlchen. Foto: Paulin
Der Frühling ist da, und die Vögel singen. Rotkehlchen und Zaunkönig schmettern kräftig ihr Lied, aber für manche Vögel wie den Spatz reicht es nicht zu einem melodischen Gesang. Im Rausch der Frühlings-Hormone wird jetzt mehr und lauter gesungen.
Bei Vögeln ist der durch den Gesang erzeugte Schalldruck enorm. Der Gesang des Zaunkönigs kann sogar in mehreren Hundert Metern Entfernung noch gehört werden. Die enorme Leistung des Stimmorgans ist mit seinem Bau zu erklären. Im Gegensatz zum Menschen liegt es tief unten an der Luftröhre, wo diese sich in die beiden Lungenflügel gabelt. Die Luft wird beim Herauspressen der Luft ohne Umwege und mit höchstem Druck über das Stimmorgan geleitet. Dünnhäutige Membranen werden hier in Schwingungen versetzt. Muskeln an der Luftröhre können die Töne zusätzlich verändern. So kann eine zauberhafte Gesangsstrophe oder ein langgezogener Ton erzeugt werden.
Viel Gesang kostet viel Kraft. Wenn zwei rivalisierende Buchfink-Männchen gegeneinander singen, dann erkennen die Weibchen durchaus, wer voller Power ist und mit wem es sich zu paaren lohnt. Ein Buchfink kann an einem Frühlingstag 4000 Strophen hervorbringen. Das macht in der Summe fast dreieinhalb Stunden Gesang aus. Aber nicht jedes Männchen vermag für sein umworbenes Weibchen zufriedenstellende Leistungen zu zeigen.
Vogelmännchen in der Stadt singen gegen den Verkehr an
Noch schwieriger wird es für singende Männchen in der Stadt. Sie müssen gegen den Verkehrslärm ansingen. Dazu sind, so zeigen es Untersuchungen, beim Rotkehlchen statt der üblichen 80 Dezibel oft mehr als zehn Dezibel zusätzlich nötig. Das bedeutet eine Verdoppelung des Schalldrucks, und wir nähern uns dem Lärmpegel eines Presslufthammers. Hier kommen Vogelmännchen an die Grenze ihrer Leistung.
Sie müssen also Energie einsparen und das machen sie so: Sie passen sich dem Lärm der Umgebung an. An Wochenenden wird leiser gesungen, morgens und abends je nach Berufsverkehr ebenfalls. Oder die Männchen machen durch interessante Variationen im Gesang besonders auf sich aufmerksam. Das ist für die Forschung sehr interessant: Entstehen in Stadt und Land möglicherweise neue Gesangstypen und Arten wie das Wald-Rotkehlchen oder die Stadt-Amsel? Forscher haben Hinweise, dass diese Entwicklung eingesetzt haben könnte.
Was kreucht und fleucht denn da in der Region? Wolfgang Kurtze, Vorsitzender der Lions-Naturschutz-Stiftung, schreibt über Phänomene und Kuriositäten in der Natur. Das TAGEBLATT veröffentlicht die Artikel des promovierten Biologen in loser Reihenfolge.

Zaunkönig. Fotos: Schaffhäuser (3)

Goldammer.

Blaukehlchen.