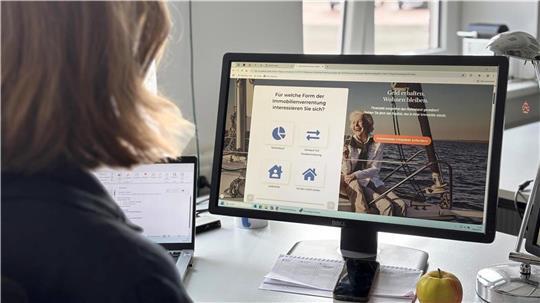Mangel entdeckt: Balkonkraftwerke müssen jetzt vom Netz

In Deutschland sind laut Bundesnetzagentur rund 230.000 Balkonkraftwerke installiert. Foto: dpa
Die Bundesnetzagentur macht ernst: Wegen eines Mangels an einem Bauteil müssen bestimmte Geräte nachgerüstet werden. Wer betroffen ist.
Besitzer von Balkonkraftwerken mit einem bestimmten Wechselrichtertyp sind von dessen Herstellerfirma aufgefordert, ihre Anlagen vorübergehend vom Stromnetz zu trennen. Nach einer Anordnung der Bundesnetzagentur veröffentlichte der chinesische Wechselrichterhersteller Deye am Freitag auf seiner Homepage eine entsprechende Bitte. Es geht um den Mikro-Wechselrichter DEYE SUN600G3-EU-230. Als Grund nannte die Firma ein fehlendes Zertifikat, das die Übereinstimmung des Produktes mit den behördlichen Anforderungen sicherstellen solle. Wie viele Wechselrichter in Deutschland von der Aufforderung betroffen sind, wurde zunächst nicht bekannt.
Wechselrichter wandeln den von Steckersolargeräten produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um. Im einfachsten Fall muss für den Anschluss nur ein Stecker in eine vorhandene Steckdose gesteckt werden. In Deutschland waren der Bundesnetzagentur Anfang Juli rund 230.000 installierte Anlagen bekannt. Für knapp 137.000 davon - also mehr als die Hälfte - liegt das Inbetriebnahmedatum im laufenden Jahr.
Balkonkraftwerke bei Prüfung durchgefallen
Das Unternehmen versicherte, dass keine Gefahren bekannt seien, die durch den Betrieb der Wechselrichter entstehen könnten. „Es ist uns kein einziger Vorfall bekannt, bei dem durch dieses Produkt ein Personen- oder Sachschaden entstanden wäre.“

Über einen Wechselrichter wird der erzeugte solare Gleichstrom in Haushaltsstrom mit 230 Volt umgewandelt. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn
Die Bundesnetzagentur bestätigte die Angaben. Bei den Wechselrichtern des Typs SUN600G3-EU-230 sei der Netz- und Anlagenschutz fehlerhaft. Die Behörde verwies auf die dazu geltende Norm, bei deren Nichteinhaltung die Geräte nicht am Verteilnetz betrieben werden dürften. Bei Stichprobenmessungen hätten betroffene Geräte allerdings auch ohne das im bemängelten Wechselrichter fehlende Bauteil abgeschaltet. Ein zusätzlicher Schutz sei ohne ein solches Bauteil aber nicht vorhanden. Ermittlungen zu eventuell weiteren Wechselrichter-Typen des Herstellers Deye liefen noch. Über den Sachverhalt hatte zuvor das Magazin „Stern“ berichtet.
Mangel bei Balkonkraftwerken: China-Hersteller will nachrüsten
Deye hat nach eigenen Angaben bereits eine Nachrüstung entwickelt, die gerade in der Zertifizierung sei. Die Kundinnen und Kunden sollen dann eine kostenlose Nachrüstung erhalten. „Die Wechselrichter können unmittelbar nach der Installation der Nachrüstung wieder ans Netz gehen“, betonte das Unternehmen. Wie genau die Nachrüstung zu den betroffenen Kunden gelangen soll, wurde zunächst nicht bekannt.
Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) empfahl Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich mit dem Hersteller oder Händler der Balkonsolaranlage in Verbindung zu setzen und gegebenenfalls Unstimmigkeiten der Anlage anzusprechen. Auch ein Gewährleistungsanspruch sei zu prüfen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen betonte: „Grundsätzlich sind Steckersolar-Geräte sicher, es ist uns kein Fall eines gefährlichen Verhaltens eines solchen Gerätes in Deutschland bekannt.“
Funktionsweise und Vorteile der Balkonkraftwerke
Die kleinen und vergleichsweise billigen Balkonkraftwerke haben seit vergangenem Jahr - auch wegen der stark gestiegenen Strompreise - an Popularität gewonnen. In der Regel bestehen sie aus ein bis zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Dieser wandelt den Solarstrom in Haushaltsstrom um, der direkt in die Steckdose eingespeist werden kann. Mit dem Strom können dann Haushaltsgeräte betrieben werden. Im Gegenzug wird weniger Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Ob sich ein solches System lohnt, hängt laut Verbraucherzentrale unter anderem von Anschaffungspreis und Strompreis ab, aber auch davon, ob das Modul möglichst lange und viel Sonne bekommt.
Trotz des starken Wachstums spielen die Kraftwerke aber noch keine allzu große Rolle bei der Stromerzeugung. Selbst wenn man die 30 000 Anlagen mit unklarem Status hinzuzählt, kommen sie laut Bundesnetzagentur nur auf eine Gesamtleistung von 170 Megawatt und dürften im Jahr maximal 170 Gigawattstunden erzeugen. Das sind 0,3 Promille des deutschen Stromverbrauchs.
Erleichterungen und Pläne der Ampel
Die Bundesregierung will die Installation der Anlagen allerdings weiter erleichtern und dem Thema so einen weiteren Schub geben. Nach einem Referentenentwurf des Justizministeriums soll Mietern und Wohnungseigentümern die Installation erleichtert werden. Sie sollen einen gesetzlichen Anspruch auf das Anbringen der Geräte bekommen. Die Notwendigkeit, einen Antrag auf Installation beim Vermieter oder der Eigentümerversammlung zu begründen, würde damit entfallen.
Das Wirtschaftsministerium strebt zudem eine Anhebung der Leistungsgrenze von 600 auf 800 Watt sowie vereinfachte Meldepflichten für Steckersolargeräte an. Bisher müssen diese im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen und beim Netzbetreiber gemeldet werden. Diese Doppelmeldung soll entfallen.
Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW), Carsten Körnig, begrüßte die Vereinfachungen, sprach zugleich aber von entsprechendem Handlungsbedarf für die größeren Dach- und andere Photovoltaikanlagen.
Der BSW erwartet, dass der Anteil, den Steckersolargeräte zur Deckung des Strombedarfs in Deutschland liefern, auch absehbar vergleichsweise gering bleibt. Doch die Geräte ermöglichten vielen Menschen eine aktive Mitwirkung und Teilhabe an der Energiewende „und erhöhen so auch die Akzeptanz der Erneuerbaren Energien”, betont Körnig. Die Vorteile der Anlagen lägen in der technischen Einfachheit sowie in der kostengünstigen Anschaffung als Einstieg in die eigene Solarstromerzeugung für Mieterinnen und Mieter sowie Wohnungseigentümer. Zu ähnlichen Einschätzungen kommt auch das Bundeswirtschaftsministerium in seiner Photovoltaik-Strategie.
Regionale Verteilung der Balkonkraftwerke
Innerhalb Deutschlands sind die im Marktstammdatenregister registrierten Anlagen übrigens recht ungleich verteilt. Besonders beliebt sind sie ausgerechnet im Norden Deutschlands. In Mecklenburg-Vorpommern kommen auf 1000 Einwohner 5 Anlagen, in Schleswig-Holstein sind es 4,2 und in Niedersachsen 3,8. Der Süden mit Bayern und Baden-Württemberg liegt dagegen unter dem deutschen Durchschnitt von 2,7. Schlusslichter sind die Stadtstaaten mit Werten zwischen 1 und 1,5. Sie haben angesichts ihrer Bebauungsstruktur aber auch schlechtere Ausgangsbedingungen für die Anlagen. (dpa)