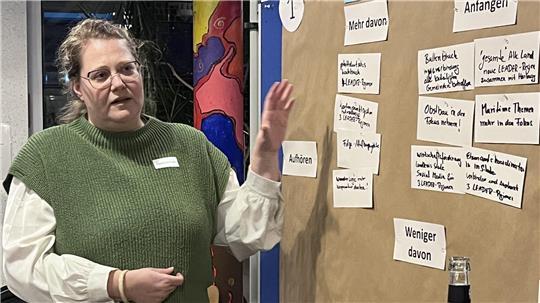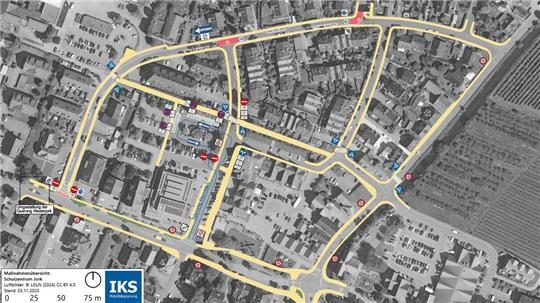Millionenschäden: Dieser Schädling bedroht den Obstbau im Alten Land

Die Marmorierte Baumwanze könnte in Kürze den Obstbau an der Niederelbe bedrohen. Foto: Esteburg
Der Obstbau an der Niederelbe schlägt Alarm: Im Norden ist ein neuer Schädling auf dem Vormarsch. Jetzt fürchten die Obstbauern den Saugbiss der Marmorierten Baumwanze, doch diese sind nicht ohne Feinde. Das Obstbauzentrum Esteburg setzt auf Kampfinsekten.
In Italien hat das Insekt im Obst- und Gemüseanbau wiederholt Millionenschäden angerichtet. Globalisierung und Klimawandel haben zur Verbreitung des Schädlings beigetragen, sagt Professor Dr. Roland Weber vom Obstbauzentrum Esteburg in Jork-Moorende. Deutschlandweit beobachten die Obstbauern den Vormarsch mit Sorge, so der Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Obstbau, Joerg Hilbers. Nach der aus Fernost stammenden Kirschessigfliege werde der Obstbau erneut durch einen invasiven Schädling bedroht.
In Italien habe dieser neue Schädling im Jahr 2019 Schäden im Wert von rund 500 Millionen Euro angerichtet. In Südtirol lag der Anteil wanzengeschädigter Früchte vor drei Jahren im Ökoanbau bei zehn bis 22 Prozent, in der Integrierten Produktion bei vier bis zehn Prozent. Die Erzeuger fürchten nicht den Biss der Marmorierten Baumwanze, sondern ihr Saugen. Dieses habe in Zentral- und Südeuropa bereits zu „massiven Ernteverlusten“ geführt. Der Grund: Ihr Speichel ist toxisch, das Gewebe des Kern- und Steinobstes wird geschädigt, die Äpfel und Birnen werden deformiert. Diese können nicht mehr als Tafelobst vermarktet werden. 2021 gab es im Norden ähnliche Symptome, für diese sei jedoch die Graue Gartenwanze verantwortlich.
Klimawandel bringt Wanze gen Norden
Die Marmorierte Baumwanze stammt ursprünglich aus Ostasien. Über die USA (und den weltweiten Transport von Waren) gelangte sie nach Europa. 2004 sei diese Wanze erstmals in der Schweiz, 2020/2021 in Hannover beziehungsweise in Hamburg von Biologen dokumentiert worden. Dank der klimawandelbedingten steigenden Temperaturen geht es weiter in Richtung Norden. Die ersten Sichtungen gab es jeweils in den Städten – wegen höherer Temperaturen. Die adulten Tiere überwintern in Gebäuden.
Im Mai paaren sich die Tiere, im Juni, Juli und August legen die Weibchen zwischen 50 und 150 Eier auf die Unterseite der Blätter. Weber rechnet damit, dass die ersten Sichtungen an der Niederelbe an Trompeten- und nicht Obstbäumen erfolgen werden. „In der Phase der beginnenden Besiedlung einer Region werden an diesen Wirtsbäumen oft die ersten Funde gemacht“, sagt der Biologe. Auf diese wollen die Esteburg-Forscher – in den Gärten in den Wohngebieten – ein Auge haben. Adulte Tiere, Eiablage und erste Nymphen könnten den Nachweis erbringen, dass diese invasive Art die Elbe erreicht hat.
Obstbau hofft auf Hilfe vom Bund
Mit Blick auf das gegenwärtige Klima an der Niederelbe rechnet der Esteburg-Experte mit einer Generation. In Italien gebe es oft bereits eine zweite, verbunden mit einem höheren Befallsdruck. Das lasse hoffen, dass dieser Schädling nicht so stark wie südlich der Alpen zuschlagen werde. Trotz alledem. „Die hohe Dynamik der nach Norden ausgerichteten Verbreitung dieser Art lässt vermuten, dass ihr Erscheinen an der Niederelbe unmittelbar bevorsteht“, sagt Weber.
„Wir stehen im engen Austausch mit Italien“, so Hilbers. Wirksame, zugelassene Insektizide gebe es nicht. Ohnehin würde ihr Einsatz im Mai und Juni auch Nützlinge weghauen. „Das wollen wir nicht“, betont Weber. Im engen Kontakt mit Wissenschaftlern in ganz Europa arbeitet das Esteburg-Team an Alternativen bei der Bekämpfung.
Die wichtigsten Nachrichten aus der Region via TAGEBLATT Telegram
morgens, mittags und abends kostenlos aufs Smartphone erhalten
So könnten mit den im Blattdünger enthaltenen Mikronährstoffen wie Zink, Kupfer oder Zitronensäure-Chelate, die Darmbakterien der Wanzen-Nymphe einen über die Rübe bekommen, ihre Ernährung und Entwicklung wäre gestört. Ob dieser Effekt obstbaulich nutzbar ist, müsse noch erforscht werden. Ein anderer Ansatz sei, die Invasoren mit Lockstoffen (Aggregationspheromone) an einem Ort in großer Zahl zu versammeln und mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen. Die Methode könnte mit Fallen auch zur Kontrolle genutzt werden.
Vielversprechender sei allerdings die Einnetzung der Anlagen – wie bei der Kirschessigfliege. Mit Lockstoff behandelt, könnten die Netze auch zum Wanzen-Fangen dienen. Wenn die Invasion starte, müssten Praxisversuche folgen. Ähnlich wie in Italien favorisiert der Obstbau allerdings den Einsatz natürlicher Gegenspieler (Nützlinge). So könne die mittlerweile auch in Europa heimische Samurai-Wespe zum Helfer der Obstbauern werden.

Samuraiwespe zwischen Wanzeneiern. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg kartiert bundesweit das Vorkommen.Foto: Klaus Schrameyer/LTZ Augustenberg/dpa
Wie geht das? Parasitoide Samurai-Wespen legen ihre Eier in Eiern der Marmorierten Wanze ab. Dort ernähren sich die Larven bis zu ihrem Schlüpfen von der Wanzenbrut. Sie fressen die Wanzeneier von innen auf.
Hilbers und Weber hoffen, dass die Behörden dem Samurai-Einsatz zustimmen werden, es gab Gespräche in der Arbeitsgruppe zum Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. In Deutschland fehlt immer noch eine Nützlingsverordnung.
„In Deutschland fehlt ein klares Entscheidungsverfahren zum biologischen Pflanzenschutz“, klagt Weber. Jedes Bundesland müsse beim Bundesamt für Naturschutz einen eigenen Antrag stellen, über den von Baden-Württemberg aus dem Frühjahr 2020 ist noch immer nicht entschieden worden. Weber hofft, dass die Behörden die Obstbauern nicht im Stich lassen: „Die Samurai-Wespe ist der Schlüssel bei der Bekämpfung der Marmorierten Baumwanze.“
Kartierung der Wanze
Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg kartiert Rahmen eines Verbundprojektes mit dem Julius Kühn-Institut (JKI) und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) bundesweit das Auftreten dieser Wanzen. Ziel dabei ist es durch eine zielgerichtete Modellierung der zukünftigen Ausbreitung ein bundesweit funktionierendes Vorwarnsystem aufbauen zu können. Es ist Teil des Projekts Prog/RAMM. Das hat zum Ziel, die Ausbreitung von invasiven Schadinsekten in Deutschland zu ermitteln und eine Risikoanalyse durchzuführen.
Fotomeldungen an: pflanzenschutz-insekten@ltz.bwl.de.

Professor Dr. Roland Weber. Foto: Vasel