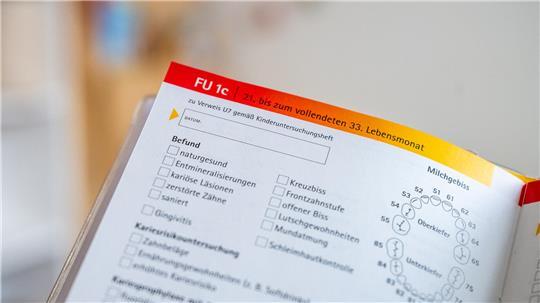50 Jahre Notruf: Wann die 112 wählen – und wann nicht?

Symbolbild. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
110 und 112 sind die Nummern für den Notfall, auf den Tag genau seit 50 Jahren. Grund genug, auf die Geschichte des Notrufs zu blicken - und zu klären: Wann sollte man die 112 wählen? Und was ist kein Fall für den Notruf?
Von Ricarda Dieckmann und Valeria Nickel
Seit 50 Jahren gibt es für Hilfesuchende in ganz Deutschland drei Ziffern, um am Telefon die Feuerwehr, einen Krankenwagen oder die Polizei zu rufen - 110 und 112. Am 20. September 1973 beschließen die westdeutschen Regierungschefs von Bund und Ländern, die Notfallnummern flächendeckend einzuführen.
Eine zentrale und gebührenfreie Notrufnummer ist seinerzeit keine Selbstverständlichkeit: Anfang der 1970er Jahre ist die Polizei nur in rund 1000 von 3785 Fernsprechortsnetzen unter der 110 zu erreichen. Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung wenige Monate vor Einführung der Rufnummern hervor. Ansonsten müssen Betroffene im Notfall erst einmal den richtigen Kontakt suchen, etwa im Telefonbuch.
Warum die Ziffernfolge 110?
Dreistellige Nummern sind damals aus technischen Gründen die kürzesten, die bundeseinheitlich zur Verfügung stehen. Außerdem hat die 110 den Vorteil, dass sie sich an den damals verbreiteten Telefonen auch im Dunkeln leicht wählen lässt: Die Ziffern 1 und 0 befinden sich auf der Wählscheibe an den jeweiligen Enden der Skala.
Grundsätzlich existiert die 110 für die Polizei schon seit 1948, wie die Bundesnetzagentur angibt. Als die 110 für Polizei und 112 für Feuerwehr ausgewählt werden, wird demnach die Ziffernfolge 111 außen vor gelassen, um offenbar technische Probleme zu vermeiden.
In der DDR ist ab etwa Mitte der 1970er Jahre neben der 110 und 112 über die 115 der zentral gesteuerte Rettungsdienst zu erreichen. Nach der Wende wird diese sogenannte Schnelle Medizinische Hilfe aufgelöst. Heute können Bürger und Bürgerinnen unter der 115 Fragen zu Behördenanliegen loswerden.
Bis in West-Deutschland die 110 und 112 nach dem Beschluss von 1973 tatsächlich überall verfügbar sind, dauert es noch einige Jahre. Nach Angaben der Björn Steiger Stiftung, die sich maßgeblich für die einheitlichen Notrufnummern einsetzte, wird das letzte Ortsnetz Ende 1979 damit ausgestattet.
Rund 41.000 Anrufe gehen an einem Werktag bei Deutschlands Notrufzentralen ein
Ute und Sigfried Steiger gründeten die Organisation 1969, nachdem ihr achtjähriger Sohn Björn wegen eines Verkehrsunfalls ums Leben gekommen war. Der Krankenwagen kam erst nach einer Stunde und das Kind starb auf dem Weg in die Klinik an einem Schock. Weil das Elternpaar danach feststellte, dass stundenlanges Warten auf Hilfe die Regel war, starteten sie ihr Engagement für eine bessere Notfallhilfe in Deutschland und forderten bei Politikerinnen und Politikern die bundesweiten Notrufnummern.
Mittlerweile gehen rund 41.000 Anrufe an einem durchschnittlichen Werktag bei Notrufzentralen in Deutschland ein, zeigen Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Bundesanstalt für Straßenwesen für die Jahre 2016 und 2017. Am Wochenende seien es etwa 10 000 Anrufe weniger. Demnach stuft das Leitstellenpersonal 52,5 Prozent des Einsatzaufkommens als Notfälle ein, der Rest entfällt in die Kategorie Krankentransport.
Kopfschmerzen sind kein Fall für den Notruf
Problematisch sei, dass zu viele Menschen den Notruf auch in weniger gravierenden Situationen riefen, wie etwa bei Kopfschmerzen, sagt Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn Steiger Stiftung. „Das ist absolut kein Einsatzszenario für den Notarzt“, betont er. Früher hätte die Bevölkerung eine hohe Hemmschwelle bei Notrufen gehabt, doch seit ungefähr 15 Jahren gebe es das umgekehrte Phänomen.
Wenn nicht gerade Lebensgefahr besteht und alle Arztpraxen geschlossen sind, sollten Betroffene dem Gesundheitsministerium zufolge statt der 112 den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 anrufen. Bei Bedarf kommen dann die Ärztinnen und Ärzte, die unter dieser Nummer erreicht werden, auch zu Betroffenen nach Hause.
Ein einheitlicher Fragenkatalog fehlt
Steiger weist auf ein weiteres Problem hin: dass in Deutschland nicht einheitlich geregelt sei, was nach Eingang eines 112-Notrufs in der Zentrale passiere. Es gebe bundesweit keinen standardisierten Fragenkatalog. Hilfesuchende seien daher auf die Fähigkeiten der jeweiligen Mitarbeiter angewiesen.
Der Stiftungspräsident fordert auch „eine viel höhere Digitalisierung“ im Rettungswesen, etwa um die Patienten zu steuern. Andere Länder seien dahingehend weiter. In Österreich etwa könne die Leitstelle beispielsweise Asthma-Erkrankten einen QR-Code schicken, um in der nächstgelegenen Apotheke das notwendige Medikament zu erhalten. Dadurch würden dann keine Rettungskräfte gebunden.
Ein Großteil der Forderungen der Stiftung wurden Anfang September von der entsprechenden Regierungskommission aufgegriffen. Sie schlägt einheitliche Vorgaben zur Organisation, zu den Leistungen und zur Bezahlung der Rettungsdienste vor. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verkündete, den Rettungsdienst reformieren zu wollen. „Jetzt ist es entscheidend, dass die empfohlenen Maßnahmen und Schritte auch konsequent und zeitnah in die Praxis umgesetzt werden“, teilte Stiftungspräsident Steiger dazu mit.
Wann sollte ich die 112 wählen?
Vielleicht hat die kleine Tochter Reinigungsmittel geschluckt und wirkt nun benommen. Oder an der Bushaltestelle ist ein älterer Mann bewusstlos in sich zusammengesackt. Oder man selbst ist zu Hause auf der Treppe ausgerutscht und kann sich nur unter extremen Schmerzen bewegen.
In Situationen wie diesen ist klar: Hilfe wird gebraucht - und zwar schnell. Einige zögern, wenn es darum geht, einen Notruf abzusetzen oder sich aus eigener Kraft in die Notaufnahme zu begeben. Andere tun es, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Wie trifft man die richtige Entscheidung? Ein Notfallmediziner klärt auf.
„Wenn es sich um eine plötzlich aufgetretene, lebensbedrohliche Situation handelt, die keinen Aufschub erlaubt, sondern die Hilfe sofort kommen muss“, sagt Martin Massmann. Er ist Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme der Schön Klinik Neustadt (Schleswig-Holstein).

Der Notruf 112 ist nicht in jeder Situation die richtige Wahl. Sind möglicherweise Leben in Gefahr, sollte man aber keine Scheu haben, einen Notruf abzusetzen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
Aber wenn das Herz wie wild klopft oder man unter Schock steht, kann man die Lage nicht immer mit kühlem Kopf beurteilen. Das weiß auch der Notfallmediziner. „Man kann natürlich von den Patienten in der Lage nur schwerlich verlangen, dass sie einschätzen können: Ist das lebensbedrohlich oder nicht?“
Wer sich unsicher ist, wählt besser den Notruf. „Lieber einmal häufiger als einmal zu wenig“, sagt Massmann. Denn die Fachleute in der Leitstelle folgen im Telefonat einem Fragebogen, der auf eine schnelle Einschätzung der Situation ausgelegt ist. Und sie entscheiden dann, was am besten zu tun ist - ob etwa ein Rettungswagen mit Notarzt oder Notärztin losgeschickt wird.
Was sind konkrete Beispiele für medizinische Notfälle?
Ein Anzeichen für eine möglicherweise lebensbedrohliche Situation ist laut Massmann Atemnot. Denn sie kann auf verschiedene ernste Erkrankungen hindeuten, etwa auf eine Lungenembolie, eine allergische Reaktion oder einen Herzinfarkt. Bei letzterem kommen oft Schmerzen in der Brust oder im Rücken zwischen den Schulterblättern dazu.
Ein Schlaganfall ist ebenfalls ein Notfall. Auf ihn deuten eine verwaschene Sprache oder einseitige Lähmungen von Arm, Bein oder Gesicht hin. Treffen kann es auch Jüngere, zehn bis 15 Prozent der Schlaganfälle kommen laut der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft bei Menschen vor, die jünger als 55 Jahre sind.
Bewusstlosigkeit kann ebenso ein Anzeichen für einen Schlaganfall sein. Aber auch für andere ernsthafte Erkrankungen wie einen Herz-Kreislauf-Stillstand, einen Krampfanfall oder eine Vergiftung - ebenfalls Situationen, in denen es schnelle Hilfe braucht.
Das kann auch für einen Unfall gelten. Denn mögliche Knochenbrüche gehören in die Notaufnahme. Ebenso starke Blutungen - vor allem dann, wenn man gerinnungshemmende Medikamente einnimmt. Bei einem Erwachsenen kann ein Blutverlust von einem Liter lebensbedrohlich sein, heißt es von der Schön Klinik Neustadt.
Ärztliche Hilfe ist auch nach Stromunfällen gefragt, selbst dann, wenn es einem nach einem Stromschlag erst mal gut geht. Auch Stunden später kann es noch zu einem Herzstillstand kommen. Die Schön Klinik rät daher, keine Zeit zu verlieren, wenn nach einem Stromunfall Herzstolpern, Atemnot oder ein Krampfgefühl auftreten.
Und was sind keine Fälle für die Notaufnahme oder den Notruf 112?
„Wenn man einen fieberhaften Infekt, eine starke Erkältung oder einen Magen-Darm-Infekt hat, sind das keine Situationen für den Notruf“, sagt Notfallmediziner Massmann. Denn die Kapazitäten der Einsatzkräfte sind begrenzt. „Das Problem: Man besetzt sozusagen sowohl den Disponenten in der Leitstelle als auch den Rettungswagen.“ Mit der Folge, dass jemand, bei dem es wirklich ernst ist, möglicherweise länger auf Hilfe warten muss.
Aber auch bei einem Infekt kann man nicht immer abwarten, bis am nächsten Morgen oder am Montag die Arztpraxis ihre Türen wieder öffnet. Dann ist allerdings eine andere Telefonnummer die bessere Wahl: 116 117.
Hinter dem Angebot steht die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wählt man die 116 117, erreicht man rund um die Uhr den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der Rat geben kann, was bei den entsprechenden Beschwerden am besten zu tun ist. Und zum Beispiel Bereitschaftspraxen vorschlägt, die man aufsuchen kann. Bei Bedarf kommt eine Ärztin oder ein Arzt auch zu Hause vorbei.
Auf der Webseite gibt es auch ein Patienten-Navi, das gesundheitliche Beschwerden online abfragt. Am Ende steht ein Rat, wie man nun am besten weiter vorgeht.
Wie erleichtere ich Rettungskräften die Arbeit?
Damit kann man schon am Telefon beginnen. Die Gesprächsführung sollte man dem Disponenten oder der Disponentin in der Leitstelle überlassen, rät Martin Massmann. Wird man am Telefon unterbrochen, sollte man das nicht persönlich nehmen.
Macht sich ein Rettungswagen auf den Weg zur verletzten Person, sollte jemand die Rettungskräfte in Empfang nehmen, zum Beispiel an der Straße. „Schlecht ist, wenn der Rettungswagen kommt, aber den Einsatzort nicht finden kann“, sagt Martin Massmann. Denn dann gehen wertvolle Minuten verloren.
Sind die Rettungskräfte da, gilt: „Es ist wenig geholfen, wenn jemand dazwischenfunkt“, sagt Massmann. Etwa durch Worte oder auch, wenn man durch den Arbeitsbereich der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter läuft. Angehörige halten sich am besten zurück und antworten erst mal nur auf die Fragen, die die Rettungskräfte stellen.
Und wenn es ins Krankenhaus geht? „Natürlich ist es wichtig, dass die Patienten fürs Krankenhaus etwas zum Anziehen mitbekommen“, sagt Martin Massmann. „Aber noch wichtiger ist ein Medikamentenplan, eventuell Arztbriefe oder auch eine Patientenverfügung, falls vorhanden. Und was man auch braucht: eine Telefonnummer von Angehörigen.“
Rettungskräfte in Empfang nehmen
Macht sich ein Rettungswagen auf den Weg zur verletzten Person, sollte jemand die Rettungskräfte in Empfang nehmen, zum Beispiel an der Straße. "Schlecht ist, wenn der Rettungswagen kommt, aber den Einsatzort nicht finden kann", sagt Martin Massmann. Denn dann gehen wertvolle Minuten verloren.
Sind die Rettungskräfte da, gilt: "Es ist wenig geholfen, wenn jemand dazwischenfunkt", sagt Massmann. Etwa durch Worte oder auch, wenn man durch den Arbeitsbereich der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter läuft. Angehörige halten sich am besten zurück und antworten erst mal nur auf die Fragen, die die Rettungskräfte stellen.
Diese Dokumente sind fürs Krankenhaus wichtig
Und wenn es ins Krankenhaus geht? "Natürlich ist es wichtig, dass die Patienten fürs Krankenhaus etwas zum Anziehen mitbekommen", sagt Martin Massmann. "Aber noch wichtiger ist ein Medikamentenplan, eventuell Arztbriefe oder auch eine Patientenverfügung, falls vorhanden. Und was man auch braucht: eine Telefonnummer von Angehörigen." (dpa)