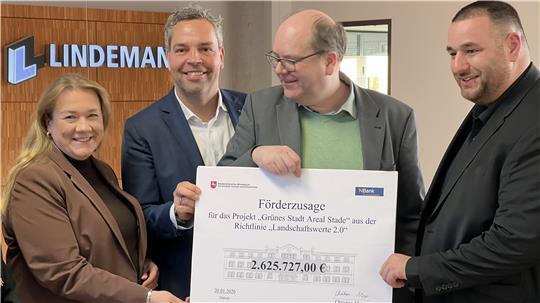Wasserstoff-Achse zwischen Stade und Sydney geknüpft

Zusammenarbeit (von links): Christian Groß und Florence Lindhaus aus Australien haben mit IHK-Chef Christoph von Speßhardt und IHK-Präsident Matthias Kohlmann eine Absichtserklärung geschlossen. Foto: IHK Elbe-Weser
Das klingt exotisch: Das Wasserstoffnetzwerk Nordostniedersachsen hat eine Absichtserklärung mit der German-Australian Hydrogen Alliance geschlossen. Was dahintersteckt und warum auch der Bund auf den Kreis Stade setzt.
Stade. Die GAHA wurde im Oktober 2020 ins Leben gerufen und ist eine Initiative der Deutsch-Australischen Auslandshandelskammer (AHK Australien). H2.N.O.N-Vorstand und Hauptgeschäftsführer der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, Christoph von Speßhardt, erklärt: „Der Import von Wasserstoff und seinen Derivaten wie Ammoniak ist für Deutschland eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Erreichen der Klimaschutzziele und die vorausschauende Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes.“
Australien setzt auf den Export von Wasserstoff
Australien sei in dieser Hinsicht „ein hervorragender Energiepartner“, da es seine Erzeugungskapazitäten massiv ausbauen möchte und mit seiner Wasserstoffstrategie stark auf Exporte setze. Von Speßhardt: „Mit der unterzeichneten Vereinbarung können wir nun auch Nordostniedersachsen intensiver mit australischen Wasserstoffakteuren vernetzen.“
Die Absichtserklärung beinhalte den regelmäßigen Austausch über Wasserstoff-Entwicklungen in Deutschland und Australien und Erfahrungen in Wasserstoffprojekten. Sie ist Ergebnis einer zehntägigen Wasserstoff-Delegationsreise nach Australien von H2-Akteuren aus der Region.
Forschung an grünem Wasserstoff wird gefördert
Deutschland und Australien arbeiten schon seit mehreren Jahren an einer Wasserstoffkooperation, mit dem Ziel, grünen Wasserstoff aus dem Kontinent nach Deutschland zu liefern. Mit HyGATE gibt es inzwischen bereits ein Deutsch-Australisches Förderprogramm für Forschungsarbeiten, die den Import von nachhaltigen Energieträgern aus Australien und den Export von deutschen Klimaschutztechnologien unterstützen.
Die nun geschlossene Vereinbarung soll die Verbindung zwischen H2.N.O.N, der IHK Elbe-Weser und Einrichtungen in Australien stärken.
Pläne für das deutsche Wasserstoffnetz
Für den Wasserstoff-Transport fehlt derzeit noch die Infrastruktur. Das soll sich ändern - wie, dazu hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) jüngst Details vorgestellt.
„Wir müssen jetzt ein Netz aufbauen für einen Energieträger, der noch nicht da ist“, beschrieb Habeck die Lage. Oder in den Worten des Vorstandsvorsitzenden der FNB Gas, des Zusammenschlusses der überregionalen Gastransportunternehmen, Thomas Gößmann: „Wir gehen in Vorleistung, um das Henne-und-Ei-Problem zu lösen.“
Worum geht es beim Wasserstoffkernnetz?
Das Kernnetz soll die wichtigsten Leitungen der künftigen Wasserstofftransport- und -importinfrastruktur umfassen, insgesamt 9700 Kilometer an Leitungen. Habeck verglich das mit den Autobahnen im Straßennetz.
Der Landkreis Stade ist mit der sogenannten Energietransportleitung ETL 182 beteiligt. Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) plant den Neubau der ETL 182 zwischen den bestehenden Netzpunkten „Elbe Süd“ südlich der Elbe auf Höhe der Elbinsel Lühesand im Landkreis Stade und der bestehenden Verdichterstation in der Stadt Achim im Landkreis Verden. Damit soll das Gas, das an den neu entstehenden Flüssiggas-Terminals (LNG) in Brunsbüttel und Stade-Bützfleth angelandet wird, in den Ferngasnetz eingespeist werden.
Später könne Wasserstoff als Energieträger dazukommen. Die Ausspeisungskapazität solle bei 270 Terawattstunden liegen. Für das Jahr 2030 rechne man derzeit mit einem Bedarf von 95 bis 130 Terawattstunden, sagte Habeck. „Das heißt, wir planen für die Zukunft.“ Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) lobte das als weitsichtig. 60 Prozent des Wasserstoffkernnetzes sollen laut Gößmann aus einer Umrüstung existierender Gasleitungen abgedeckt werden.
Wer bezahlt das alles?
Die Investitionskosten von 19,8 Milliarden Euro für das Kernnetz soll die Privatwirtschaft übernehmen. Allerdings springt die Bundesregierung mit einem sogenannten Amortisationskonto ein. Die Idee dahinter: eine Streckung der Entgelte über einen längeren Zeitraum. So sollen die Netzentgelte für Wasserstoffabnehmer zunächst gedeckelt werden, um den politisch gewünschten Wasserstoff-Hochlauf nicht zu gefährden.
Da in den ersten Jahren aber nur wenige Nutzer des Kernnetzes erwartet werden, bleibt angesichts der hohen Investitionskosten eine Kostenlücke. Diese Differenz soll der Bund mit dem Amortisationskonto zwischenfinanzieren. Wenn später mehr Nutzer ans Netz angeschlossen sind und Entgelte zahlen, soll das Geld wieder hereinkommen. Wenn das bis 2055 nicht passieren sollte, gleicht der Bund den Fehlbetrag weitgehend aus, die Betreiber des Wasserstoffkernnetzes sollen aber bis zu 24 Prozent übernehmen. „Mit dieser „Entgeltverschiebung“ tragen spätere Nutzer somit die Aufbaukosten des Netzes mit“, erklärte das Ministerium.
Was ist mit kleineren Leitungen?
Die Planung für die Landes-, Bundes- oder Kreisstraßen des Wasserstoffnetzes, wie Habeck sie nannte, muss noch gemacht werden. Das soll nach dem dafür nötigen Beschluss des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch beginnen, sagte Habeck.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärte, es sei richtig, mit der Planung des Kernnetzes zu starten, merkte aber an: „Um den Industriestandort Deutschland klimaneutral und zukunftsfest zu machen, müssen jetzt dringend die Rahmenbedingungen für die Verbindungsleitungen zum Kunden (Verteilnetze) geschaffen werden.“ 1,8 Millionen potenzielle Wasserstoffkunden im Industrie- und Gewerbebereich seien am Gasverteilnetz angeschlossen. Ohne kleinteiliger verästelte Leistungen würden diese nicht erreicht.
Welche Rolle soll Wasserstoff künftig spielen?
Wasserstoff ist ein wichtiger Hoffnungsträger der Energiewende, der künftig helfen soll, den Ausstoß an Treibhausgasen unter anderem in der Industrie zu drücken.
Woher soll der Wasserstoff kommen?
Deutschland wird nach Einschätzung Habecks auf die Dauer 30 bis 50 Prozent seines Bedarfs an Wasserstoff selbst produzieren und den Rest importieren. Das soll über Pipelines passieren oder in Form von Ammoniak mit dem Schiff. Habeck betonte, dass Deutschland damit unabhängiger von Importen werde, als dies derzeit bei Öl, Gas und Steinkohle der Fall sei, wo fast 100 Prozent eingeführt würden. Ein Teil der künftigen Wasserstoff-Importe soll aus Norwegen kommen, die Bundesregierung hofft aber auch auf afrikanische Länder wie Nigeria, die dank mehr Sonnenstunden bessere Voraussetzungen für Solarstrom haben.
Wie geht es weiter?
Das Bundeswirtschaftsministerium arbeite gerade „mit Hochdruck“ an einem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, das noch im laufenden Jahr vom Kabinett verabschiedet werden solle, sagte Habeck. Dies solle die Voraussetzungen schaffen für eine „maximale Beschleunigung“, ähnlich wie bei den schwimmenden Importterminals für Flüssiggas. (dpa/tip)