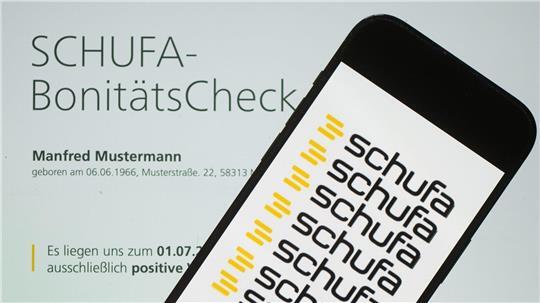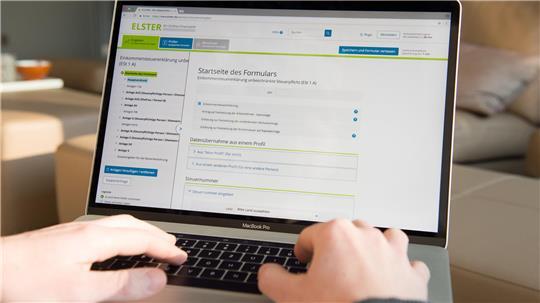Frist endet jetzt: Die besten Tipps für die Steuererklärung
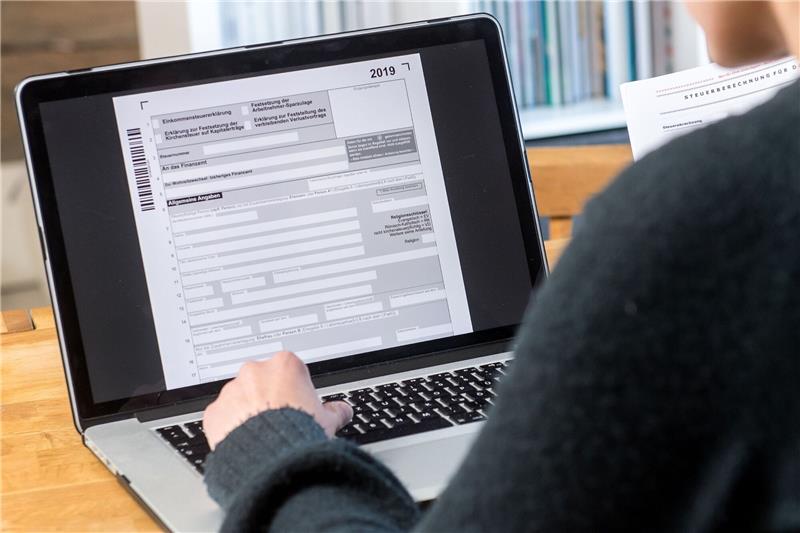
Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und nicht von einem Steuerberater betreut wird, muss dies bis zum 30. September tun. Foto: dpa
Nur wenige erstellen gerne eine Steuererklärung. Dabei gibt es im Schnitt 1000 Euro Steuern zurück - pro Jahr und Kopf. Lohnt sich also. Besonders dann, wenn diese Ereignisse eintreten.
Beschäftigte zahlen jeden Monat Lohnsteuer - ohne dass sie diese selbst abführen müssen. Das erledigt nämlich der Arbeitgeber. Was der Arbeitgeber jedoch nicht weiß und auch gar nicht berücksichtigen kann: Welche Ausgaben seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über das Jahr haben, die die Steuerlast senken könnten. Deshalb tut er so, als gäbe es diese Bürden nicht - und führt damit unter Umständen mehr Steuern ab, als die Beschäftigten dem Fiskus schuldig sind.
Umso wichtiger ist es für Beschäftigte, nach Ablauf eines Jahres mit der Steuererklärung Bilanz zu ziehen und dem Finanzamt anzuzeigen, welche Ausgaben angefallen sind, die ihre Steuerlast senken könnten. Nur so können eventuell zu viel gezahlte Steuern zurückerstattet werden. Bestimmte Lebensereignisse machen eine Erstattung besonders wahrscheinlich.
Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und nicht von einem Steuerberater betreut wird, muss dies bis zum 30. September tun.
Wir zeigen Ihnen, welche das sind:
1. Heirat oder Eintragung einer Lebenspartnerschaft
Wer heiratet oder eine Lebenspartnerschaft eintragen lässt, kann im selben Jahr erstmals vom sogenannten Ehegattensplitting profitieren. In den meisten Fällen verringert sich laut Bund der Steuerzahler dadurch die Steuerlast.
Partner geben dafür eine gemeinsame Steuererklärung ab und wählen die Zusammenveranlagung. Das Finanzamt addiert die Einkommen der Partner zu einem Gesamteinkommen und teilt dieses durch zwei. Anhand des halben Gesamteinkommens wird dann die Steuerlast bemessen, die anschließend einfach verdoppelt wird. Weil niedrige Einkommen weniger stark besteuert werden, kann das Steuervorteile bringen.
Je größer der Einkommensunterschied der Partner ist, desto eher lohne sich die Zusammenveranlagung, sagt Florian Machnow vom Steuer-Start-up Taxfix. Verdienen beide gleich viel, ändert sich an der Steuerlast hingegen nichts.
2. Aufnahme einer Tätigkeit im Laufe des Jahres
Ob Arbeitslosigkeit, Sabbatical oder erstmalige Aufnahme eines Jobs etwa nach dem Studium: Wer nur einen Teil des Jahres angestellt war, kann meist ebenfalls mit einer ordentlichen Steuererstattung rechnen.
Der Grund: Bei der monatlichen Entgeltzahlung wird davon ausgegangen, dass der Lohn das ganz Jahr über fließt, so der Bund der Steuerzahler. Entsprechend hoch ist die abgeführte Steuer. Wer aber nur einen Teil des Jahres Lohn überwiesen bekommen hat, der hat ein deutlich geringeres Jahreseinkommen - und dadurch auch eine geringere Steuerlast als angenommen.
3. Weite Wege zur Arbeit
Steuerzahler, die weite Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen, können diese steuerlich gelten machen. Für die ersten 20 Kilometer können je 30 Cent pauschal geltend gemacht werden. Ab dem 21. Kilometer sind es sogar je 38 Cent - egal wie der Weg zurückgelegt wird.
Steuerzahler, deren gesamte Einnahmen unterhalb des Grundfreibetrags von derzeit 10 908 Euro liegen, aber als Fernpendler mit mehr als 20 Kilometern Arbeitsweg hohe berufliche Ausgaben haben, können laut Bund der Steuerzahler besonders profitieren. Sie können sich mit der Abgabe der Steuererklärung die Mobilitätsprämie sichern.
4. Hohe Auslagen für berufliche Tätigkeit
Wer jobbedingt teure Anschaffungen tätigt oder Fortbildungen macht, die der Arbeitgeber nicht bezahlt, kann die Ausgaben als Werbungskosten absetzen, rät der Bund der Steuerzahler. Das senkt die Steuerlast.
Auch die Arbeit im Homeoffice kann die Werbungskosten in die Höhe treiben. Für jeden Heimarbeitstag berücksichtigt der Gesetzgeber pauschal sechs Euro.
5. Hohe Sonderzahlung
Ob Bonus für gute Arbeit oder Abfindung für die vorzeitige Auflösung des Arbeitsvertrags: Einmalige Sonderzahlungen können dazu führen, dass besonders viel Lohnsteuer vom Arbeitgeber abgeführt wird. Häufig zu viel. Wer eine Steuererklärung abgibt, kann sich zu viel gezahlte Steuern zurückholen.
6. Berufsbedingter Umzug
„Ein Umzug aus beruflichen Gründen kann bei den Werbungskosten berücksichtigt werden“, sagt Florian Machnow. Wer also einen neuen Job in einer anderen Stadt antritt, aus dem Ausland zurückkehrt oder durch den Umzug mindestens eine Stunde Fahrtweg pro Tag zum derzeitigen Job spart, kann die Kosten für den Umzug in der Steuererklärung ansetzen.
Etwa für Fahrtwege zu Wohnungsbesichtigungen, Maklergebühren bei Mietwohnungen, doppelte Mietzahlungen und den Transport des Hausrats. Die Kosten müssen allerdings belegt werden können.
Sonstige Umzugskosten, etwa für die Renovierung der alten Wohnung, die Ummeldung und die fachgerechte Installation von Lampen, können zusätzlich mit der sogenannten Umzugskostenpauschale berücksichtig werden, schreibt das Ratgeber-Portal „Finanztip“. Berechtigte können dafür aktuell 886 Euro in der Steuererklärung ansetzen. Ziehen Ehe- oder Lebenspartner, ledige Kinder, Stief- oder Pflegekinder mit um, gibt es pro Person weitere 590 Euro on top.
7. Kirchensteuer bezahlt
„Wer in Deutschland Mitglied einer Kirche ist, muss bis zu neun Prozent Kirchensteuer zahlen“, sagt Machnow. „Das Gute: Sie kann abgesetzt werden.“ Steuerlich wird die Kirchensteuer genauso wie eine Spende behandelt. Sie wird bei den Sonderausgaben eingetragen.
8. Energiepreispauschale nicht erhalten
Steuerzahler, die die Energiepreispauschale im Jahr 2022 in Höhe von 300 Euro nicht erhalten haben, obwohl sie Anspruch darauf hatten, können sich das Geld über die Steuererklärung holen. Bei Abgabe berücksichtigt das Finanzamt die Pauschale automatisch.
9. Hohe außergewöhnliche Belastungen durch Krankheit
Ob Arztkosten, Aufwendungen für rezeptpflichtige Medikamente oder den benötigten Rollstuhl: „Haben Steuerzahler in einem Jahr besonders viele Ausgaben für eigene Krankheitskosten getragen, kann sich das steuermindernd auswirken“, so der Bund der Steuerzahler. Eingetragen werden die Kosten bei den außergewöhnlichen Belastungen.
Voraussetzung ist, dass die Krankheitskosten die zumutbare Belastungsgrenze überschreiten. Diese hängt von der Höhe des Einkommens, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder ab.
10. Kapitalerträge
Wertpapiere gewinnbringend verkauft, Dividenden erhalten? Hat ein Steuerzahler auf Kapitalerträge 25 Prozent Abgeltungsteuer bezahlt, obwohl dessen Grenzsteuersatz unter 25 Prozent liegt, kann er sich die Differenz vom Finanzamt erstatten lassen. Das betrifft laut dem Bund der Steuerzahler vor allem Niedrigverdiener, Rentner und Studierende.
11. Handwerkerleistungen oder energetische Gebäudesanierung
Führen Handwerker Arbeiten in den eigenen vier Wänden aus, kann das zunächst ins Geld gehen. Doch die Aufwendungen können die Steuerlast senken, schreibt „Finanztip“. 20 Prozent der Arbeitskosten, höchstens aber 1200 Euro können abgesetzt werden. Dazu muss die gesamte Rechnungssumme sowie der Lohnanteil in der Anlage „Haushaltsnahe Dienstleistungen“ eingetragen werden.
Deutlich höher kann die Steuerersparnis „Finanztip“ zufolge ausfallen, wenn die selbst bewohnte Immobilie saniert wird. Auch dann können 20 Prozent der Kosten, höchstens aber 40 000 Euro abgesetzt werden. In der Steuererklärung ist dafür die Anlage „Energetische Maßnahmen“ auszufüllen. Voraussetzung ist etwa, dass für die Maßnahme nicht gleichzeitig eine staatliche Förderung in Anspruch genommen wurde.
12. Ausgaben für Kinderbetreuung
Wer Kinder hat, darf anfallende Kosten für die Betreuung von der Steuer absetzen - etwa Kita-Gebühren oder das Schulgeld. Laut Taxfix können so zwei Drittel der Kosten als Sonderausgaben abgesetzt werden, höchstens aber 4000 Euro pro Kind.
Diese 9 Posten sind nicht steuerlich absetzbar
Heizungswartung, Arbeitsweg oder die Spende an eine Hilfsorganisation - Arbeitnehmer können viele Ausgaben in der Steuererklärung geltend machen. Auch wenn der Betrag nicht erstattet wird, mindert er zumindest das Einkommen, auf das am Ende Steuern zu zahlen sind. Doch die Absetzbarkeit hat Grenzen. Nicht alles kann in der Steuererklärung aufgelistet werden. Das sind 9 typische Beispiele.
1. Der dunkle Anzug
Arbeitskleidung und deren Reinigung gelten für Arbeitnehmer zwar theoretisch als Werbungskosten. Aber: „Bei Kleidung sind die Finanzämter ausgesprochen pingelig“, sagt Sigurd Warschkow von der Lohnsteuerhilfe für Arbeitnehmer. Bedeutet: Die Kleidung muss berufstypisch sein und darf nicht anderweitig getragen werden können.
Durchgewinkt werden Richterrobe oder Arztkittel, nicht aber ein dunkler Anzug für die Firma. „Wenn Sie als Banker einen klassischen dunkelblauen Anzug brauchen, könnten Sie den ja auch privat tragen“, erklärt Warschkow. So argumentierte auch der Bundesfinanzhof, als ein Trauerredner Anzug und Krawatte in Schwarz als Berufskleidung absetzen wollte.
2. Kosten für Friseur- und Kosmetikbesuche
Gleiches gilt für Kosten für Friseur- und Kosmetikbesuche. Selbst wer bei seiner Arbeit ein äußerlich gepflegtes Erscheinungsbild an den Tag legen muss, weil er oder sie etwa Kundenkontakt hat oder vor der Kamera steht, kann diese Kosten nicht steuerlich geltend machen. Der Grund: Auch hier sind die Aufwendungen nicht in berufliche und private Veranlassung zu trennen. Deswegen sei selbst ein teilweiser Werbungskostenabzug nicht möglich, so Warschkow.
3. Sachversicherungen
Einige Versicherungen können als Sonderausgaben oder Werbungskosten abgesetzt werden. Doch reine Sachversicherungen gehören nicht dazu: also Hausrat-, Kfz-Kasko-, Wohngebäude- oder Reisegepäckversicherung. „Auch die private Rechtsschutz-, Mietrechtsschutz- und Verkehrsrechtsschutzversicherung ist nicht abziehbar, wenn kein beruflicher Bezug besteht“, sagt Jana Bauer, stellvertretende Geschäftsführerin beim Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine.
4. Das Material für den Handwerker
Wer zu Hause die Profis reparieren lässt, kann Steuern sparen. Aber: Während Lohn-, Fahrt- und Arbeitskosten abgesetzt werden können, gilt das nicht für das in Rechnung gestellte Material. Wer also zum Beispiel einen Parkettboden verlegen lässt, kann die Arbeit des Bodenlegers steuerlich absetzen, muss das Material selbst aber herausrechnen. Daher sind aufgeschlüsselte Rechnungen für die Steuererklärung wichtig.
5. Führerschein
Auch wenn ein Arbeitnehmer den Führerschein braucht, um mit dem Auto zur Arbeit zu fahren - da zur privaten Lebensführung gehörend, kann er nicht in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Ausnahme: „Menschen mit einer Gehbehinderung können die Kosten als außergewöhnliche Belastung geltend machen“, sagt Jana Bauer.
Anders ist es, wenn man etwa Busfahrerin oder LKW-Fahrer werden will: „Kosten für den Führerschein sind als Werbungskosten absetzbar, wenn ein Arbeitnehmer diesen zwingend zur Erbringung der Arbeitsleistung braucht und den Job oder eine besser bezahlte Tätigkeit sonst nicht bekommen hätte“, so Sigurd Warschkow.
6. Scheidungskosten
Bis 2013 waren Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastung absetzbar. „Der Bundesfinanzhof hat aber seine Rechtsprechung drastisch geändert“, sagt Warschkow. „Er geht davon aus, dass die Kosten eben keine solche Belastungen darstellen, da sie - anders als zum Beispiel Krankheiten oder Behinderungen - nicht zwingend oder für den Betroffenen unausweichlich sind.“
7. Haushaltsnahe Dienstleistung hinterm Gartenzaun
Tätigkeiten, die im eigenen Haushalt von Dienstleistern ausgeführt werden, können bis zu einer Obergrenze abgesetzt werden. Allerdings endet der Haushalt am Gartenzaun. „Daher können Kosten für Schneeräumen zwar für das Stück von der Tür zum Zauntor angesetzt werden“, sagt Sigurd Warschkow, „nicht aber der Winterdienst auf den das Grundstück umgebenden Wegen.“
Keine Regel ohne Ausnahme. So kann ein Hundeausführdienst steuerlich geltend gemacht werden. „Laut dem Bundesfinanzhof wird ein wesentlicher Teil der Dienstleistung mit der Abholung und dem Zurückbringen des in den Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenommenen Hundes räumlich in dem Haushalt erbracht“, erklärt Jana Bauer die Urteilsbegründung.
8. Vereinsbeiträge
Mit Spenden lassen sich Steuern sparen. Aber: Nicht jede Zahlung an eine gemeinnützige Organisation ist eine Spende. Verfolgt ein Verein uneigennützige Ziele, erklärt Christina Georgiadis von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe, dann ist ein Mitgliedsbeitrag absetzbar. „Aber nicht, wenn der Vereinszweck freizeitnah ist und ein Mitglied selbst etwas davon hat.“
Nicht absetzbar sind also zum Beispiel Beiträge an einen Karnevals-, Sport- oder Tierzuchtverein. Und auch wenn eine Aufnahmegebühr oft „Beitrittsspende“ genannt wird: Solche Zahlungen sind ebenfalls nicht als Sonderausgabe absetzbar.
9. Schönheitsoperationen
Viele von der Krankenkasse nicht gezahlte Krankheitskosten sind als außergewöhnliche Belastungen absetzbar - ein rein kosmetischer Eingriff gehört jedoch nicht dazu. „In der Regel werden kosmetische Operationen nicht als zwangsläufig angesehen“, sagt Jana Bauer.
Nur im Einzelfall können Kosten für kosmetische OPs oder Haartransplantationen abzugsfähig sein. Nämlich dann, wenn sie aus medizinischer Sicht aufgrund einer psychischen Erkrankung notwendig sind. „Hierzu muss vor Beginn der Maßnahme ein Amtsarztattest vorgelegt werden“, so Bauer.
- Umfrage zeigt: Deutsche überschätzen ihr Finanzwissen
Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Aktie und einem Fonds? Und lässt der Begriff „Rentenlücke“ Sie kalt, weil Sie aktiv Vorsorge betreiben? Einer repräsentativen Umfrage der IU Internationalen Hochschule zufolge zeigen sich Deutsche in Sachen Finanzbildung zumindest sehr selbstbewusst - nicht unbedingt zu Recht.
Vier von fünf Befragten (79,7 Prozent) schätzen ihre eigene finanzielle Bildung demnach „eher gut“ bis „sehr gut“ ein. Als wichtigste Quellen für ihr Finanzwissen gaben die Befragten unter anderem die Familie (41,3 Prozent), allgemeine Ratgeberbücher und -zeitschriften (37,1 Prozent) sowie Finanzwebseiten (36,6 Prozent) an. Von Influencerinnen und Influencern in den Sozialen Medien lassen sich immerhin zwei von fünf Deutschen (19,6 Prozent) informieren.
Im Rahmen der Studie hat die Hochschule auch das tatsächliche Finanzwissen der Befragten anhand eines Tests untersucht - und die Ergebnisse sprechen eine andere Sprache. Von maximal 20 möglichen Punkten erreichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schnitt nur etwas mehr als die Hälfte (10,7 Punkte). Studienleiter Prof. Johannes Treu schließt aus der deutlichen Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Wissen, dass das eigene Finanzwissen oft überschätzt wird. Das kann bei Anlageentscheidungen gefährlich sein.
Wer bei der Erstellung der Steuererklärung helfen darf
In Deutschland regelt das Steuerberatungsgesetz, wer bei der Erstellung einer Steuererklärung helfen darf. Und das sieht nur bestimmte Personen und Vereinigungen dafür vor. Aber wer darf denn nun?
In allererster Linie Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, sagt Alexander Kislinger von der Lohnsteuerhilfe Bayern. Diese Personengruppe sei zur unbeschränkten Hilfestellung befugt. Selbst Lohnsteuerhilfevereine dürften zum Beispiel nur beschränkt, das heißt im Rahmen ihrer Beratungsbefugnis, Hilfe leisten. Sie sind etwa auf Arbeitnehmer und Rentner spezialisiert. Erzielt ein Steuerpflichtiger zu versteuernde Einkünfte aus Land- oder Forstwirtschaft oder einem Gewerbebetrieb, müssen Lohnsteuerhilfevereine passen.
Allen nicht genannten Personen und Vereinigungen ist eine geschäftsmäßige Hilfeleistung gesetzlich verboten.
Ausnahmen gelten aber für unentgeltliche Unterstützung. So dürfen etwa Verlobte, Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner, Pflegeeltern oder Pflegekinder sowie Verwandte oder Verschwägerte gerader Linie helfen, wenn sie dafür nicht entlohnt werden. Verwandte oder Verschwägerte gerader Linie sind zum Beispiel Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder eines Steuerpflichtigen oder dessen Partnerin beziehungsweise Partners.
„Unzulässig ist damit generell die Hilfeleistung gegenüber anderen Personen wie beispielsweise Lebensgefährten, Freunden und Bekannten“, sagt Alexander Kislinger - und zwar ganz unabhängig davon, ob die Hilfe entgeltlich oder unentgeltlich erbracht wird.
Ausnahmen hiervon lässt die Rechtsprechung laut Kislinger nur zu, sofern es sich um „steuerlich irrelevante Unterstützungsleistungen“ wie „Schreib- und Übersetzungsarbeiten oder die bloße Datenübermittlung einer elektronischen Steuererklärung“ handelt. „Dasselbe gilt grundsätzlich für nicht auf Wiederholung angelegte einmalige Tätigkeiten“, so Kislinger.
Wer trotz Verbots Hilfe leistet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann.
Aber warum ist das eigentlich so, dass nicht jeder helfen darf? „Die Regelungen des Steuerberatungsgesetzes sollen Steuerpflichtige vor einer Fehlberatung schützen“, sagt Kislinger. So werde gewährleistet, dass nur fachkundige Personen und Vereinigungen tätig werden, die über die notwendige fachliche und persönliche Zuverlässigkeit und Qualifikation Verfügen. Zudem sei die sachgerechte Steuerberatung auch im Interesse des Steueraufkommens und der Allgemeinheit und diene der Steuerrechtspflege.
Kleines Einkommensteuer-Glossar: von Freibetrag bis Reichensteuer
Bund, Länder und Gemeinden haben im vergangenen Jahr rund 896 Milliarden Euro durch Steuern eingenommen. Die Einkommensteuer trug dazu einen guten Batzen bei. Wer dabei wie viel zahlen muss, ist genau festgelegt und steigt mit wachsendem Einkommen bis zu Grenzwerten an. Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts gab es 2019 in Deutschland rund 42,6 Millionen Menschen, die Einkommensteuer zahlten. Ein Mini-Glossar zum Mitreden:
Zu versteuerndes Einkommen: Das ist nicht identisch mit dem jährlichen Bruttoeinkommen. Denn Steuerfreibeträge lassen es in der Regel deutlich niedriger ausfallen, zum Beispiel durch den Grundfreibetrag. Er beträgt im Moment für Singles 10.908 Euro und für Ehepaare das Doppelte. Wer weniger verdient, zahlt ohnehin keine Einkommensteuer. Jenseits dieser Grenze steigt die Besteuerung progressiv in fünf Tarifzonen an. Das heißt, je höher das zu versteuernde Einkommen ausfällt, desto mehr Abgaben werden fällig. Mindern können die Steuerlast aber weitere Freibeträge wie zum Beispiel der Kinderfreibetrag. Dabei können Eltern für jedes Kind unter 18 Jahren im Moment einen Steuervorteil in Höhe von 8952 Euro geltend machen.
Spitzensteuersatz: Ab einem zu versteuernden Einkommen von 62.810 Euro bis 277.826 Euro greift für Singles aktuell der Spitzensteuersatz, bei Ehepaaren gilt der doppelte Wert. Jeder Euro, der über der Grenze liegt, wird mit 42 Prozent besteuert. Das ist nach Angaben des Verbands Vereinigte Lohnsteuerhilfe der niedrigste Spitzensteuersatz, den Deutschland je hatte. Der höchste Wert habe zwischen 1975 und 1989 bei 56 Prozent gelegen. Nach einer FDP-Anfrage an den Bundestag fielen 2018 rund 4 Millionen Menschen in Deutschland zumindest mit Teilen ihres zu versteuernden Einkommens unter den Spitzensteuersatz. Vergleicht man ihn mit anderen europäischen Ländern, liegen 42 Prozent eher im unteren Mittelfeld. Die höchsten Steuersätze für Spitzenverdiener finden sich nach Angaben der Ergo-Versicherung in Finnland (56,95 Prozent), Dänemark (56 Prozent) und Schweden (52,8 Prozent). Die niedrigsten Sätze gibt es danach in Bulgarien und Rumänien (10 Prozent) sowie Ungarn (15 Prozent).
Höchststeuersatz: Die so genannte Reichensteuer greift in Deutschland, wenn die Grenze des Spitzensteuersatzes überschritten wird - also ab einem zu versteuernden Einkommen von 277.826 Euro oder der doppelten Summe bei Ehepaaren. Alles, was über der Grenze liegt, wird dann mit 45 Prozent besteuert. Nach den jüngsten Angaben des Statistischen Bundesamts zahlten im Jahr 2019 rund 114.500 Menschen in Deutschland diesen höchsten Steuersatz. (dpa/tmn)