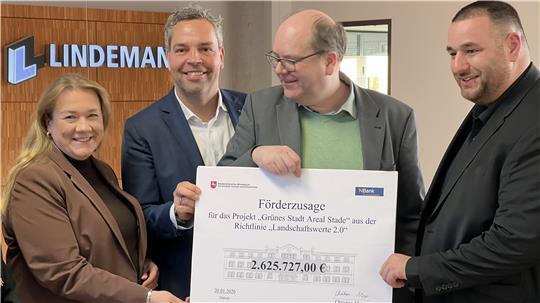Ist der Stader LNG-Tanker ein Klimasünder?

Diese Spezialschiffe können LNG aufnehmen, erwärmen und gasförmig machen. Foto: dpa
Stellen die Gaslieferungen per Tankschiff eine Klima- und Umweltsünde dar? Ein Vergleich auf Facebook legt genau das nahe und wird zahlreich geteilt. Das ist dran an den Vorwürfen.
Jetzt ist klar, welcher LNG-Tanker künftig in Stade anlanden wird: die „Transgas Force“. Das schwimmende Gas-Terminal wird ab sofort in der Lloyd Werft in Bremerhaven fit gemacht für seinen Einsatz in Stade. Das Schiff wird das technische Herzstück des Stader LNG-Terminals, es soll das mit Tankern aus aller Welt angelieferte tiefgekühlte und somit verflüssigte Gas wieder regasifizieren und an Land pumpen.
Doch neben der Begeisterung, dass es ab diesem Winter mit dem Import von Flüssiggas im Stader Seehafen beginnen kann, werden auch immer wieder kritische Stimmen laut. Umweltschützer beklagen beispielsweise die Herkunft des umzuwandelnden Gases aus den USA, wo es mittels der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wird, oder äußern Sorge, dass giftiges Biozid in Wasser gelange.
Und: Glaubt man Beiträgen in Sozialen Netzwerken wie Facebook, dann ist auch die Klimabilanz der eingesetzten Tankschiffe verheerend: Ein Schiff stoße bei zehn Tagen Fahrt so viel CO2 aus wie alle Autos der Welt in fünf Jahren, heißt es in einem oft geteilten Facebook-Beitrag. Ist das so?
Ein LNG-Tanker verursacht nur einen Bruchteil der Emissionen des Autoverkehrs
Die Bewertung: Die Angaben sind falsch. Der weltweite Verkehr stößt pro Jahr und auch in fünf Jahren weitaus mehr CO2 aus als ein Gastanker bei einer Fahrt. Die Schiffe fahren zudem nicht mit Roh- oder Schweröl, sondern mit einem Teil der Ladung.
Die Fakten: Will man Erdgas per Schiff transportieren, so wird es in der Regel stark heruntergekühlt und dadurch verflüssigt. Man spricht von LNG (Liquefied Natural Gas). Hintergrund ist, dass das Volumen um das 600-fache verringert wird und sich somit mehr Gas verschiffen lässt.
Die LNG-Tankschiffe werden, anders als zum Beispiel die meisten Containerschiffe, nicht mit Schweröl angetrieben. Sie nutzen einen Teil der Ladung, sogenanntes Boil-Off-Gas, das in den Tanks verdampft. Daher ist bereits die erste Annahme im Sharepic falsch. Es ist unklar, woher die Fehlinformation stammt, ein Gasfrachter verbrauche pro Tag 320 Tonnen Rohöl.
Eine Modellrechnung mit Angaben zum Seeweg und zum Gasverbrauch zeigt, dass die Emissionen eines LNG-Tankers eine ganz andere Größenordnung haben, als der Facebook-Beitrag andeutet:
- Die Route aus Emiraten, also den Staaten am Persischen Golf, beträgt bis in einen deutschen Hafen bei Nutzung des Suezkanals rund 7000 Seemeilen. Bei einer Geschwindigkeit von 20 Knoten wäre ein Schiff demnach rund 15 Tage unterwegs.
- Das für den Antrieb verwendete Boil-Off-Gas macht pro Tag rund 0,1 Prozent des transportierten LNGs aus. Bei 15 Tagen sind es entsprechend 1,5 Prozent. Ein durchschnittlicher Tanker fasst rund 150.000 Kubikmeter LNG. Demnach würden rund 2250 Kubikmeter LNG für den Antrieb verwendet.
- Diese Menge Gas hat einem Umrechner des Versorgers Primagas zufolge einen Brennwert von rund 16 Millionen Kilowattstunden. Wendet man für die Berechnung der CO2-Emissionen einen Faktor von 247 Gramm pro Kilowattstunde an, so ergibt sich ein theoretischer CO2-Ausstoß von rund 4000 Tonnen.
Der Autoverkehr verursacht weitaus mehr CO2. Allein für Deutschland und für das Jahr 2022 meldete das UBA einen Wert von 148 Millionen Tonnen CO2 und Äquivalenten. In der EU betrug der Wert im Jahr 2021 rund 740 Millionen Tonnen. Berücksichtigt man alle Länder der Welt und einen Zeitraum von fünf Jahren, liegt er entsprechend noch deutlich höher. Die Emissionen einer einzelnen Fahrt eines LNG-Tankers sind, der Beispielrechnung folgend, dagegen verschwindend klein.
In der Debatte um die Energieversorgung kursieren immer wieder falsche Zahlen. Die Deutsche Presse-Agentur widerlegte im April 2022 bereits einen ähnlichen falschen Vergleich von LNG-Tankern und dem Autoverkehr.
Streit um Biozid: Wie viel Chlor ist für das LNG-Terminal nötig?
An Deutschlands erstem LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird seit Dezember Flüssigerdgas angelandet. Bei Reinigungsverfahren auf dem Terminalschiff werden allerdings auch chlorhaltige Abwässer in die Jade eingeleitet. Das sorgt für Ärger zwischen Umweltschützern auf der einen Seite und dem Terminalbetreiber Uniper und dem Land Niedersachsen auf der anderen Seite.
Die Umwelthilfe und andere Umweltschutzverbände sowie Anwohner und Muschelfischer kritisieren, dass mit Biozid in Form von Chlor behandelte Abwässer von dem Terminalschiff "Höegh Esperanza" in die Jade geleitet werden. Sie fürchten: Wenn kontinuierlich chlorhaltige Abwässer fließen, könnte das Natur und Lebewesen im angrenzenden Wattenmeer auf Dauer schädigen.
Der Betreiber Uniper führt dagegen an, dass der Biozid-Einsatz notwendig sei und dem "Stand der Technik" entspreche. Das sehen auch das niedersächsische Umweltministerium und die Genehmigungsbehörde, der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), so. Uniper und der NLWKN erklären, dass gesetzliche Grenzwerte eingehalten würden und nur so wenig Chlor wie betriebstechnisch nötig zum Einsatz kämen.
Das Biozid in Form von aktivem Chlor ist laut Uniper notwendig, um das sogenannte Biofouling zu verhindern. Denn um das von Tankern mit etwa minus 162 Grad angelieferte verflüssigte Erdgas auf der «Höegh Esperanza» wieder in Gas umzuwandeln, muss es an Bord mithilfe von Nordseewasser erwärmt werden. Damit die Seewassersysteme des Schiffes nicht etwa mit Muscheln oder Seepocken zuwachsen, wird Chlor eingesetzt. Dazu wird das im Seewasser enthaltene Natriumchlorid mithilfe von Elektrolyse in aktives Chlor umgewandelt. Bis zu 178 Millionen Kubikmeter chlorhaltige Abwässer dürfen mit der Reinigung der Seewassersysteme jährlich in die Jade eingeleitet werden.
Umwelthilfe und BUND wollen kürzere Laufzeiten der LNG-Terminals
Die Umwelthilfe hatte zuvor auch die Stader LNG-Pläne immer wieder kritisiert. "Diese überdimensionierte Planung muss ein Ende haben. Wir fordern eine Denkpause beim LNG-Ausbau und stattdessen mehr Anstrengungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz“, hieß es. Eine Gasmangellage bestehe weder für diesen noch für den kommenden Winter, sind sich die Umweltschützer sicher.
Der Betrieb der Terminals ist derzeit im LNG-Gesetz bis 2043, also auf 20 Jahre begrenzt. Klimaschützern ist das deutlich zu lange, weil sie dadurch die Ziele zur Reduzierung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase gefährdet sehen. Auch der BUND kritisierte die Flüssiggas-Pläne der Bundesregierung. „Der geplante Bau von LNG-Terminals schießt weit über das hinaus, was notwendig wäre, um gut durch die nächsten Winter zu kommen“, sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Brandt. Die Ampelregierung manifestiere auf Jahrzehnte eine fossile Infrastruktur. „Damit betreibt sie das Gegenteil von klimaverantwortlicher Politik.“ Auch der BUND fordert eine deutlich stärkere Befristung der Terminal-Laufzeiten und behält sich vor, auf Änderung der Genehmigungen zu klagen.