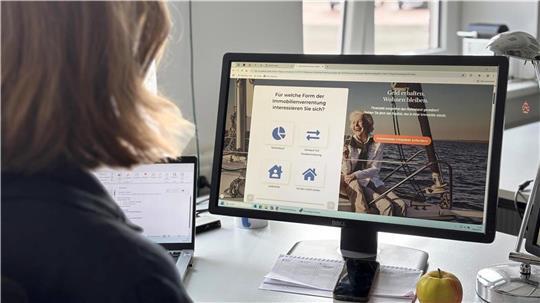Wann sich Solaranlage und Wärmepumpe im Altbau lohnen

Auch bei unsanierten Bestandsbauten kann eine Photovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe genutzt werden. Foto: Achim Banck/stock.adobe.com
Die Energiewende kann funktionieren – selbst bei unsanierten Bestandsbauten. Allerdings ist es vorteilhaft, wenn das Gebäude gewisse Voraussetzungen erfüllt. Welche das sind und welche Förderungsmöglichkeiten es 2023 gibt.
Eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) produziert eigenen Ökostrom aus Sonnenlicht. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern senkt die Stromkosten erheblich. Wer sich für Solarmodule auf dem Dach entscheidet, macht sich langfristig unabhängig von Energieengpässen und steigenden Strompreisen. Zudem erfährt die eigene Immobilie durch Solarmodule auf dem Dach eine nicht zu unterschätzende Wertsteigerung.
Mit einer Wärmepumpe ist ressourcenschonendes Heizen möglich. Die Betriebskosten fallen gering aus. Wartungsmaßnahmen sind kaum nötig, zumal sich die Geräte durch Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auszeichnen.
Ob der Einbau im eigenen Altbau möglich und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Eine Rolle spielen:
- die vorhandene Dämmung und Isolierung von Keller, Wänden und Dach,
- die installierten Heizkörper (je größer, desto besser),
- die Dichtigkeit von Fenstern und Türen,
- Ausrichtung und Neigung des Daches.
Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage im Altbau
Ist das Dach sehr alt, sollte zunächst eine Dachsanierung durchgeführt werden. Die Lebensdauer der Dacheindeckung liegt im Idealfall bei 20 bis 25 Jahren. Andernfalls besteht das Risiko, dass die PV-Anlage für in Zukunft anfallende Arbeiten am Dach zunächst abgebaut und später wieder neu montiert werden muss. Das bedeutet zusätzliche – und in diesem Fall vermeidbare – Kosten.
Für eine Solaranlage auf dem Dach ist in der Regel keine Genehmigung nötig. Eine Ausnahme gibt es bei Gebäuden, die dem Denkmalschutz unterliegen: Dafür ist die Erlaubnis der örtlichen Baubehörde erforderlich. Wer sichergehen möchte, informiert sich vorab bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung über die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Photovoltaikanlage und Batteriespeicher müssen allerdings bei der Bundesnetzagentur ins Marktstammdatenregister eintragen werden. Meldepflichtig sind neben der Inbetriebnahme, die Stilllegung, technische Veränderungen und ein Wechsel des Betreibers.
Als optimal für die Installation einer PV-Anlage gilt eine Dachfläche, die folgende Kriterien erfüllt:
- Sie ist verschattungsfrei,
- ausreichend stabil,
- nach Süden ausgerichtetund
- verfügt über eine Dachneigung von 30 bis 45 Grad.
Auch Dächer, die nicht mit diesem Idealzustand punkten können, eignen sich durchaus für eine PV-Anlage: Allerdings fällt der Stromgewinn geringer aus, wenn die Solarmodule nach Osten oder Westen ausgerichtet sind und das Dach Neigungen von unter 25 oder über 60 Grad aufweist. Lohnend sind Photovoltaik-Anlagen trotzdem, schon aufgrund ihrer umweltfreundlichen Stromerzeugung.
Verschiedene Arten von Solarmodulen
Für einen Altbau mit bereits saniertem Dach eignen sich in der Regel Photovoltaikanlagen als Aufdach-Montage. Dabei bleibt die Dachhaut unberührt. Das Anbringen der Solar-Module geht schnell vonstatten. Auch für eine gute Lüftung ist gesorgt.
Steht die Dachsanierung noch bevor, kommt auch Indach-Photovoltaik infrage. Dabei werden die Module ästhetisch-ansprechend direkt in das Dach integriert. Vorteilhaft ist bei dieser Montageart die geringere Traglast. Außerdem wird kein doppeltes Material benötigt. Bei den PV-Modulen gibt es monokristalline, polykristalline und Dünnschicht-Varianten. Die Auswahl hängt von der geplanten Größe der Anlage und der Höhe des Stromverbrauchs ab:
- Monokristalline Module erzielen mit 22 Prozent den höchsten Wirkungsgrad. Sie sind optimal auf kleinen Flächen sowie bei hohem Stromverbrauch.
- Polykristalline Module zeichnen sich durch einen etwas geringeren Wirkungsgrad von 15 bis 20 Prozent aus. Dafür sind sie günstiger.
- Dünnschicht-Solarzellen sind hauchdünn. Sie sind günstig in der Herstellung. Allerdings liegt ihr Wirkungsgrad nur bei 10 bis 13 Prozent.
Etwa 30 Prozent des mit der PV-Anlage erzeugten Stroms lassen sich direkt nutzen. Mit einem Stromspeicher sind es sogar rund 70 Prozent. Der Rest wird in das öffentliche Netz eingespeist. Auch eine Volleinspeisung ist möglich, muss aber beim Netzbetreiber vor Inbetriebnahme schriftlich angemeldet werden.
Für wen sich Solarmodule am Balkon eignen
Stecker-Photovoltaik-Geräte wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Der so erzeugte Strom wird über eine Steckdose in das Wohnungsnetz eingespeist und dort genutzt. „Vom Prinzip her sind Stecker-PV-Geräte einfache Produkte, wie viele andere Haushaltsgeräte auch“, erklärt René Zietlow-Zahl, Energieexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Sie bestehen aus einem oder zwei Modulen zuzüglich Wechselrichter sowie Anschlusskabel und sind aktuell bis zu einer Wechselrichter-Leistung von 600 Watt zugelassen. Häufig wird das Gerät an einem Balkongeländer befestigt und anschließend per Schuko Stecker mit dem Haushaltsnetz verbunden. „Benötigt wird dafür lediglich eine Außensteckdose und geeignetes Befestigungsmaterial, beispielsweise ein Dreiecksgestell“, so Zietlow-Zahl.
Stecker-PV-Geräte lohnen sich fast immer, je nach Standort und Nutzungsverhalten dauert es gegebenenfalls nur etwas länger, bis sich die Anschaffungskosten amortisieren. „Es ist keinesfalls so, dass nur Südlagen für eine Installation infrage kommen. Wichtig ist vor allem, dass der Standort möglichst wenig verschattet ist. Auch Ost-, West- und sogar Nordlagen können sich dann eignen“, erklärt der Energieexperte. Da keine Vergütung erfolgt, ist es wichtig, den erzeugten Strom direkt zu nutzen – also Elektrogeräte einzuschalten, wenn die Sonne scheint. Bei einer Leistung von 600 Watt und einem Strompreis von 40 Cent je Kilowattstunde lassen sich jährlich bis zu 200 Euro sparen. Somit kann sich ein Balkonkraftwerk schon nach wenigen Jahren rechnen. Die Geräte sind jedoch sehr langlebig, können in der Regel 20 Jahre und länger genutzt werden.
Was es bei Kauf und Anschluss zu beachten gilt
Für Solar-Anlagen und -Komponenten sowie deren Montage entfällt seit Anfang des Jahres die Mehrwertsteuer. Das gilt auch für Balkonkraftwerke. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Gerät die Norm VDE-AR-N 4105 erfüllt. Für die Installation ist eine Schuko Außensteckdose ausreichend, so dass Verbraucherinnen und Verbraucher das Gerät selbst anschließen können.
Für Mieter ist die Installation genehmigungsfrei, sofern sie keine grundlegenden baulichen Änderungen vornehmen. „Wir raten dennoch dazu, den Vermieter vorab über das Vorhaben zu informieren“, sagt Zietlow-Zahl. Etwas komplizierter ist es innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Da die WEG die Installation durch einen entsprechenden Beschluss untersagen kann, sollte hier immer vorab eine Genehmigung eingeholt werden. Nach den Plänen der Bundesregierung soll hier eine Gesetzesänderung erfolgen. Wohnungseigentümer und Mietende sollen das Recht erhalten, Stecker-PV-Geräte zu nutzen. Ob und wann diese Änderung kommt, ist aber noch unklar.
Anmeldung beim Netzbetreiber und Marktstammregister
Stecker-PV-Geräte müssen sowohl beim Netzbetreiber als auch beim Marktstammregister angemeldet werden. Netzbetreiber müssen dafür ein vereinfachtes Formular bereitstellen. Die Anmeldung im Marktstammdatenregister erfolgt online mit einer Video-Anleitung. Gut zu wissen: In beiden Fällen handelt es sich um eine Anmeldung und nicht um eine Genehmigung – eine Bestätigung muss nicht abgewartet werden. Zukünftig soll dieser Prozess vereinfacht und auf die Anmeldung im Marktstammregister reduziert werden. Darauf können die Netzbetreiber dann zugreifen.
„Wir hoffen, dass die geplanten Änderungen schnell vorgenommen und es Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter erleichtert wird, ein Steckersolargerät zu nutzen“, so Zietlow-Zahl.
Strom vom eigenen Dach: Drei Irrtümer rund um Photovoltaikanlagen
Mythos 1: „Dank Anlage auf dem Dach und Speicher bin ich unabhängig“
Diese Annahme stimmt so nicht, teilt die Verbraucherzentrale mit. Eine Photovoltaikanlage kann nur einen gewissen Anteil der Jahresstromversorgung des Haushalts übernehmen - selbst mit angeschlossenem Batteriespeicher. „Man spricht hier vom Autarkiegrad, der zwischen 25 und 90 Prozent liegen kann, je nachdem, ob ein Speicher vorhanden und wie hoch der Stromverbrauch ist“, heißt es von der Verbraucherzentrale.
Der übrige notwendige Strom muss dann in jedem Fall aus dem Netz hinzugekauft werden.
Mythos 2: „Ein Süddach ist immer besser als ein Ost-West-Dach“
Zwar erzeugt eine Photovoltaikanlage auf einem Süddach rund 20 Prozent mehr Strom als auf einem Ost-West-Dach, allerdings geht es privaten Haushalten vorwiegend um die eigene Nutzung des Stroms.
Die Verbraucherzentrale verweist hier auf entscheidende Vorteile beim Ost-West-Dach: Bei diesem verteilt sich die Einspeisung auf den ganzen Tag. Früh morgens und im späteren Tagesverlauf bekommt die Anlage dort also mehr Sonne ab. So kann auch mehr Strom selbst verbraucht werden.
Mythos 3: „Eine Anlage lohnt sich nur mit einem Batteriespeicher“
Eine Photovoltaikanlage lohnt sich finanziell auch ohne Speicher. Ob sich zusätzlich ein Stromspeicher rentiert, hängt vom Einzelfall ab.
Einerseits stehen für einen Batteriespeicher oft hohe Anschaffungskosten ins Haus. Andererseits kann sich das Speichern und der spätere Eigenverbrauch lohnen. Denn bei neuen Photovoltaikanlagen liegt die Vergütung für eine Kilowattstunde eingespeisten Stroms bei weniger als 10 Cent - Netzstrom kostet hingegen oft rund 40 Cent je Kilowattstunde.
Voraussetzungen zur Installation einer Wärmepumpe
Die Energieeffizienzklasse F ist bei Bestandsgebäuden keine Seltenheit. Eine energetische Komplettsanierung würde zwar optimale Voraussetzungen für den Betrieb einer Wärmepumpe schaffen, aber nicht jeder Hausbesitzer kann sich diese kostenintensiven Maßnahmen leisten. Fehlt eine ordentliche Dämmung von Dach, Keller und Wänden, geht Wärme verloren.
Ideal ist eine Fußbodenheizung. Die Verteilung der Heizung über eine große Fläche ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert. Ein Muss sind Dämmung und Fußbodenheizung nicht. Das zeigt eine Feldstudie des Fraunhofer Instituts, bei der 56 Altbauten mit Wärmepumpen über fünf Jahre wissenschaftlich begleitet wurden. Das Ergebnis: Wärmepumpen funktionieren trotzdem zuverlässig und erweisen sich als klimafreundlich.
Ob eine Wärmepumpe im eigenen Bestandsbau zum Heizen geeignet ist, muss im Einzelfall durch einen Fachbetrieb geprüft werden. In vielen Fällen profitieren Hauseigentümer finanziell vom Austausch ihrer Öl- oder Gasheizung gegen eine Wärmepumpe – auch ohne vorherige Sanierungsmaßnahmen. Sind nur sehr kleine Heizkörper vorhanden, kann es nötig sein, diese vorab durch größere Exemplare zu ersetzen.
Verschiedene Arten von Wärmepumpen
Auch bei Wärmepumpen gibt es verschiedene Bauarten. Diese richten sich nach der Nutzung des jeweiligen Energieträgers:
Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Eine Wasser-Wasser-Wärmpumpe holt einen Teil der Heizwärme aus dem Grundwasser. Diese Wärmepumpen-Art arbeitet besonders effizient. Gut geeignet ist sie für Hauseigentümer mit einem eigenen Brunnen auf dem Grundstück.
Sole-Wasser-Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe dieser Variante bezieht einen Teil der Heizwärme aus dem Erdreich. Nötig dafür ist eine größere, freie Fläche im Garten. Als Alternative dazu kommen Erdsonden infrage. Allerdings fällt das unter Sonderbohrungen und muss behördlich genehmigt werden.
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Bei dieser Wärmepumpe stammt die Wärmeenergie aus der Außenluft. Da es in Herbst und Winter kühl sein kann, fällt die Effizienz geringer aus. Je kühler die Außentemperatur, desto mehr Strom ist nötig, um die gewünschte Heiztemperatur zu erreichen.

Ob eine Wärmepumpe im Bestandsbau zum Heizen geeignet ist, muss im Einzelfall durch einen Fachbetrieb geprüft werden.
Welche Förderungen gibt es 2023?
Im BEG (Bundesförderung für Effiziente Gebäude) sind die Förderungsmöglichkeiten zusammengefasst. Förderungen sind bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen. Die Installation einer Wärmepumpe wird aktuell mit bis zu 40 Prozent der Investitionskosten gefördert, und auch für die Installation einer PV-Anlage gibt es attraktive Zuschüsse.
Fazit:
Die Installation einer Wärmepumpe und/oder einer Photovoltaikanlage ist im Altbau unter bestimmten Voraussetzungen möglich und sinnvoll. Vorherige Sanierungsmaßnahmen sind häufig nicht notwendig. Selbst Eigentümer von ungedämmten Bestandsgebäuden können vom Einbau einer Wärmepumpe profitieren. Hier sind die laufenden Kosten unter Umständen höher.
Zur Installation einer Aufdach-Photovoltaik-Anlage sollte die Lebensdauer der Dacheindeckung mindestens 20 bis 25 Jahre betragen. Auch muss die Konstruktion stabil genug für die Traglast sein. Mit Hilfe der PV-Anlage lässt sich der Strombedarf der Wärmepumpe zumindest teilweise aus selbst erzeugtem Strom decken.
Mit einem ergänzenden Stromspeicher ist es möglich, bis zu 70 Prozent des erzeugten Öko-Strom selbst zu nutzen. Der Rest wird gegen Vergütung ins öffentliche Netz eingespeist. Die Vorteile dieser Maßnahmen sind neben mehr Klimafreundlichkeit und langfristigen Kostenersparnissen eine gewisse Unabhängigkeit von Strompreisen und fossilen Energiequellen. (dpa/yvo/tip)

In Bezug auf Photovoltaikanlagen gibt es einige Irrtümer (Symbolbild). Foto: Pixabay/Colin McKay