Stephan Weil und Bernd Althusmann liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU, l) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor Beginn des TV-Duell zur Landtagswahl im NDR Studio. Foto: Ole Spata/dpa
Kontroverse Themen wie den Lehrermangel oder den Umbau der Landwirtschaft gibt es auch in Niedersachsens Politik genug. Doch vor der Landtagswahl interessiert viele Wähler vor allem die Frage, wie sie die immer höheren Energiepreise stemmen sollen.
Vor der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag kennt der Wahlkampf nur ein Thema: die Energiekrise. Insbesondere die CDU will die Wahl daher auch zu einer Abstimmung über die Krisenpolitik der Ampelkoalition im Bund machen. So sagte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann jüngst der „Rheinischen Post“, ein Sieg seiner Partei wäre „ein Signal, dass sich die Zeit der Ampel bereits ihrem Ende entgegen neigt“. In allen Umfragen der vergangenen Wochen lag die CDU allerdings knapp hinter der SPD um den im Land beliebten SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil. In die Karten spielt Althusmann aber, dass der Energie-Krisengipfel von Bund und Ländern Anfang der Woche ohne Ergebnisse blieb - ausgerechnet unter dem Vorsitz von Weil.
DIE THEMEN
An den Wahlkampfständen wollten die Wählerinnen und Wähler im Grunde nur über die hohen Energiepreise sprechen, berichten die Parteien unisono. Dabei gäbe es auch auf Landesebene viel zu diskutieren. Den eklatanten Personalmangel an Schulen und Kitas zum Beispiel. Den Umbau der Landwirtschaft im Land der Schweine- und Geflügelhalter. Die Transformation der Auto- und Zulieferindustrie, die zigtausende Jobs auf links dreht. Die Klimaziele oder die Corona-Politik.
Doch seit Russlands Angriff auf die Ukraine dreht sich alles um Energieversorgung und Entlastungen. Weil präsentiert sich dabei als erfahrener Krisenmanager, mit engem Draht zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Weil will Niedersachsen als Energie-Drehscheibe Deutschlands etablieren - auch wenn er frühere Positionen dafür aufgeben muss. Denn neben dem Ausbau von Wind- und Solarenergie werden an der Küste gerade nicht nur LNG-Terminals für flüssiges Erdgas im Rekordtempo durchgedrückt, auch die Gasförderung in der Nordsee ist auf einmal gewollt. CDU und FDP versuchen zudem, mit einer Weiternutzung der Atomkraft zu punkten.
In Sachen Entlastungen hat Weil ein Landesprogramm im Umfang von 970 Millionen Euro in Aussicht gestellt, finanziert aus höheren Steuereinnahmen. Herausforderer Althusmann sieht hingegen vor allem den Bund in der Pflicht, die Energiepreise zu senken.
DIE KANDIDATEN
Das Duell von Weil und Althusmann gab es 2017 schon einmal. Setzt sich Weil, der seit 2013 regiert, abermals durch, könnte er sogar Ernst Albrecht als Regierungschef mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen ablösen. Sein Vorsprung ist aber überschaubar.

Herausforderer Bernd Althusmann (links, CDU) und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).
Zurückzuführen ist das Kopf-an-Kopf-Rennen eher auf den schwachen Bundestrend der SPD denn auf eine wiedererstarkte CDU. Deren Umfragewerte stagnieren seit Monaten. Und im direkten Vergleich von Weil und Althusmann schneidet der SPD-Mann in den Umfragen regelmäßig klar besser ab. Weils ruhiges, immer freundliches Auftreten gefällt offensichtlich, auch wenn seine Konkurrenz ihm diese Art als dröge und konfliktscheu auslegt.
DIE AUSSICHTEN
In den jüngsten Umfragen lag die SPD bei 31 bis 33 Prozent, gefolgt von der CDU mit 27 bis 30 Prozent. Mit Werten von 16 bis 19 Prozent dürften die Grünen das Zünglein an der Waage sein, wenn es um die Regierungsbildung geht. Für die von Weil angepeilte Neuauflage von Rot-Grün gab es bisher eine hauchdünne Umfrage-Mehrheit. Vorsorglich hat sich der SPD-Kandidat aber auch schon zu einer Ampel mit der FDP bereiterklärt. Die war 2017 noch an den Liberalen gescheitert.
Die Fortsetzung der großen Koalition in Niedersachsen würde zu einer Blockade führen, so Weil. „Wenn ich das einmal weiter rechne auf die nächsten Jahre, dann fürchte ich, wir würden viel zu oft in einer Situation landen, wo wir uns gegenseitig blockieren“, sagte der Amtsinhaber am Freitagabend in Braunschweig.
Eine Koalition von CDU und Grünen - wie seit diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein - dürfte in Niedersachsen wohl nur dann eine ernsthafte Option werden, wenn die CDU die SPD noch als stärkste Kraft ablöst. Womöglich müsste Schwarz-Grün dann auch noch auf die FDP als dritten Partner setzen.
Allerdings sind die Liberalen auf Talfahrt: Von 10 Prozent und mehr vor einem Jahr sind sie bis auf 5 Prozent abgestürzt und müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Die AfD kann mit 9 bis 11 Prozent damit rechnen, den 2020 nach internen Streitigkeiten wegen mehrerer Austritte verlorenen Fraktionsstatus wiederzuerlangen. Die Linke (3 bis 4 Prozent) dürfte den Einzug in den Landtag erneut verpassen.
Noch völlig offen ist, was der Fokus auf die Energie- und Bundespolitik für die Wahlbeteiligung bedeutet. Treibt er die Menschen in die Abstimmungslokale oder hält er sie fern? Erwartet wird in jedem Fall ein hoher Anteil an Briefwählern.
DER BLICK AUS BERLIN
Die Bundes-SPD blickt der Niedersachsen-Wahl demonstrativ gelassen entgegen und gibt sich extrem siegessicher. Über eine Niederlage von Weil will niemand laut nachdenken. Sollte die Wahl doch verloren gehen, wäre die Erschütterung aber sicher bis Berlin zu spüren. Der latente Frust über den Absturz in den bundesweiten Umfragen seit der Bundestagswahl könnte sich Bahn brechen.
Mindestens genauso gefährlich für den Koalitionsfrieden wie eine SPD-Niederlage wäre ein Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde. Das könnte den Krawallfaktor gerade zwischen Liberalen und Grünen weiter erhöhen – vor allem mit Blick auf eine mögliche Zuspitzung der Energiekrise im Winter, mögliche weitere Entlastungsmaßnahmen, den Streit um die Atomkraft und die Schuldenbremse.
CDU-Chef Friedrich Merz hofft indes, dass seine Partei die Serie von Wahlerfolgen seit seinem Amtsantritt Ende Januar fortsetzen kann. Nachdem die CDU Ende März im Saarland aus der Regierung geflogen war, konnte sie im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Ministerpräsidentenposten verteidigen. Auch für Merz bedeutete das Rückenwind für seinen Kurs der Erneuerung der CDU in der Opposition.
Würde in Niedersachsen nun auch noch Althusmann gewählt, dürfte das für Merz der perfekte Ausstieg aus der Wahlserie dieses Jahres sein. Ob er sich allerdings einen Gefallen getan hat, als er Ende September über einen angeblichen „Sozialtourismus“ von Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland räsonierte, dürfte sich erst am Wahlabend in den Analysen zeigen. Zwar entschuldigte sich Merz am Morgen danach. Ob dies allerdings Anhänger von SPD und Grünen beeindruckt, die die CDU wohl für einen Wahlsieg bräuchte?
Die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Niedersachsen im Überblick
STEPHAN WEIL (SPD): Der 63 Jahre alte SPD-Politiker regiert das Land seit Anfang 2013 - erst mit den Grünen, zuletzt mit der CDU. Mehrfach wurde Weil auch als Kandidat für bundespolitische Ämter gehandelt, 2019 etwa stand eine mögliche Kandidatur als SPD-Bundesvorsitzender im Raum. Weil trat jedoch nicht an und begründete das auch mit seiner Verbundenheit zu Hannover.
Das mag nur die offizielle Version gewesen sein, doch tatsächlich spielt die Landeshauptstadt eine große Rolle in seinem Leben. Zwar wurde Weil in Hamburg geboren, doch mit sechs Jahren kam er nach Hannover - und nach einem Jurastudium in Göttingen kehrte er als Anwalt und Richter auch dorthin zurück. Als Hannovers Kämmerer und Oberbürgermeister schlug er schließlich seine politische Karriere ein.
Auf viele Beobachter wirkt Weil dennoch bis heute eher wie ein Beamter - die einen beschreiben seinen Stil als ruhig und freundlich, andere als dröge und konfliktscheu. Vertraulichkeit und Konsens sind ihm wichtiger als markige Sprüche. Die politischen Konkurrenten werten das als Schwäche, doch bei vielen Wählern kommt es an: In der Frage, wer Ministerpräsident werden soll, liegt Weil regelmäßig vorn.
BERND ALTHUSMANN (CDU): Der 55 Jahre alte Wirtschaftsminister versucht, sich als Erneuerer nach fast zehn Jahren Stephan Weil zu präsentieren, ist aber alles andere als ein neues Gesicht. Von 2010 bis 2013 war er Kultusminister, 2017 versuchte er zum ersten Mal, Weil abzulösen. Das misslang, obwohl die CDU in den Umfragen lange vorne lag. Seither ist Althusmann als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Menschlich kommen die beiden gut aus, heißt es. Auch im meist technokratischen Auftreten nehmen sich beide nicht viel.
Althusmann wurde in Oldenburg geboren und wuchs in der Nähe von Lüneburg auf, anschließend wurde er Offizier der Bundeswehr und studierte Pädagogik sowie Betriebswirtschaft. Aufregung gab es 2011 um seinen Doktortitel - der damalige Kultusminister räumte „mögliche handwerkliche Fehler“ ein, bestritt aber, bewusst getäuscht zu haben. Zu demselben Schluss kam schließlich die Uni Potsdam, Althusmann durfte den Titel behalten. Zwischen seinen Ministerposten leitete er zweieinhalb Jahre lang in Afrika die Vertretung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Namibia und Angola.
Mit Blick auf mögliche Koalitionen will sich Althusmann alle Optionen offen halten, auch ein erneutes Bündnis mit der SPD. Sollte er allerdings erneut nicht Ministerpräsident werden, dürfte auch sein CDU-Landesvorsitz nach sechs Jahren infrage gestellt werden.
JULIA WILLIE HAMBURG (GRÜNE): Die 36-Jährige ist offiziell Teil eines Spitzenduos ihrer Partei, aber sie steht auf Listenplatz 1 und ist öffentlich deutlich präsenter als Co-Kandidat Christian Meyer. Anfang 2013 zog sie als damals jüngste Abgeordnete in den Landtag ein, musste ihr Mandat jedoch aus gesundheitlichen Gründen schon bald mehrere Monate lang ruhen lassen. Auch ihr Studium der Politikwissenschaft brach sie ab. Im Sommer 2014 kehrte sie in den Landtag zurück, 2020 übernahm sie den Fraktionsvorsitz. Hamburg formuliert punktgenau und wird über Parteigrenzen hinweg respektiert - beides könnte ihr in etwaigen Koalitionsverhandlungen zugutekommen.

Julia Willie Hamburg, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl in Niedersachsen.
STEFAN BIRKNER (FDP): Der 49 Jahre alte Jurist hat viel Erfahrung in der Landespolitik - von 2008 bis 2012 war er Staatssekretär im niedersächsischen Umweltministerium, anschließend übernahm er dort für rund ein Jahr den Ministerposten. Den Landesvorsitz der FDP hat der gebürtige Schweizer seit 2011 inne, seit 2017 ist er auch Fraktionsvorsitzender im Landtag. Für den Koalitionsvertrag der Ampel im Bund hat Birkner den Bereich Umwelt- und Naturschutz federführend mitverhandelt. Auf Landesebene erteilte er einem Bündnis mit SPD und Grünen nach der Wahl 2017 jedoch eine Absage. Birkner ist zudem ein Schwippschwager des Grünen-Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck.
STEFAN MARZISCHEWSKI-DREWES (AfD): Der Gifhorner Facharzt für Radiologie und Allgemeinmedizin ist ein landespolitischer Neuling. Bislang ist er Fraktionsvorsitzender der AfD in Gifhorn. In der in den vergangenen Jahren oft zerstrittenen Partei ist er um Sachlichkeit bemüht und versucht, neben scharfer Kritik an der Regierung auch eigene Vorschläge einzubringen. Mit Blick auf die Wahl hat der 57-Jährige das Ziel ausgegeben, das AfD-Ergebnis von 2017 - 6,2 Prozent - zu verdoppeln. Der erst vor wenigen Monaten gewählte AfD-Landeschef Frank Rinck verzichtete wegen seines Bundestagsmandats auf die Spitzenkandidatur.
Die To-do-Liste der neuen Landesregierung
SCHULEN: Unmittelbar nach der Wahl braucht es nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW einen Nachtragshaushalt von einer Milliarde Euro, „um dem Lehr- und Fachkräftemangel an unseren Schulen durch höhere Ausbildungszahlen endlich entgegenzuwirken“, wie GEW-Landeschef Stefan Störmer sagt. SPD, CDU, Grüne und FDP sollten dafür „auf Parteien-Gezänk verzichten“, da sie die Missstände alle durch Regierungsbeteiligungen mit zu verantworten hätten. Die Unterrichtsversorgung war 2021/22 so niedrig wie zuletzt 2002.
KITAS: Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht großen Handlungsbedarf an den Kitas. Angesichts des Fachkräftemangels müsse das Land in dem Bereich aktiver werden: “Hierzu zählen die Schaffung einer dreijährigen Berufsausbildung anstelle einer zunehmenden Akademisierung genauso wie eine höhere Landesbeteiligung an den Kita-Kosten, aber auch der Verzicht auf Standarderhöhungen.“ Einige Kitas haben wegen Personalmangels schon die Betreuungszeiten gekürzt.
INDUSTRIE: Nach Ansicht der Gewerkschaft IG Metall muss das Land 50 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen, um die Transformation der Industrie in den kommenden zehn Jahren voranzubringen. Der Umbau müsse sozial und ökologisch sein. „Für uns sind Klimaschutz und die Schaffung sowie der Erhalt von Arbeitsplätzen kein Widerspruch, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille“, sagt IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger. Auf Seiten der Arbeitgeber hofft Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt bei der Wahrnehmung industriepolitischer Interessen auf eine aktive Rolle der neuen Regierung auf Bundesebene, „vor allem für den Mittelstand“.
ENERGIE: Den Unternehmerverbänden (UVN) zufolge müsse die neue Regierung sofort alles dafür tun, dass Niedersachsen zum Energieland Nummer eins in Deutschland werde. Dafür müsse das Land „Windkraft ausbauen, Wasserstofftechnologie ermöglichen, LNG-Terminals fertigstellen, Erdgasvorkommen nutzen und Stromtrassen in den Süden stärken“, sagt UVN-Hauptgeschäftsführer Volker Müller.
STADTWERKE: Der Niedersächsische Städtetag (NST) wirbt vor der Wahl für einen Schutzschirm für die Stadtwerke. Über den Landeshaushalt oder über die Förderbank NBank solle das Land „Liquiditätshilfen sowie Bürgschaften und Garantien“ bereitstellen, damit kommunale Stadtwerke in Krisensituationen darauf zugreifen können, sagt Hauptgeschäftsführer Jan Arning.
KRANKENHÄUSER: Aus Sicht des Landkreistags (NLT) ist die Situation an einigen Krankenhäusern dramatisch - nicht nur wegen der gestiegenen Energiepreise. „Zugleich gibt es bereits jetzt einen massiven Investitionsstau im Umfang von zwei Milliarden Euro. Wir fordern vom Land ein Sonderprogramm zum Abbau dieses Investitionsstaus“, sagt NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. „Für zukunftsfähige Krankenhausstrukturen ist eine Verdoppelung der jährlichen Landesmittel erforderlich“, sagt auch der Verbandsdirektor der Krankenhausgesellschaft NKG, Helge Engelke. Außerdem müssten Bürokratie abgebaut und das Klinikpersonal entlastet werden.
MEDIZINSTUDIENPLÄTZE: Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund erwartet vom Land die Finanzierung von mindestens 1200 Medizinstudienplätzen in Niedersachsen, inklusive einer neuen medizinischen Fakultät in Braunschweig. Auch darüber hinaus brauche die Universitätsmedizin für gute Forschung und Lehre mehr Geld und Personal. Die Kapazitäten waren zuletzt bereits von 598 Plätzen im Studienjahr 2017/18 auf 789 im laufenden Studienjahr 2022/23 ausgebaut worden.
UMWELTSCHUTZ: Die Umweltorganisation Nabu und BUND dringen auf mehr Artenschutz und -vielfalt. Dazu gehöre, die Landbewirtschaftung, aber auch den Ausbau der erneuerbaren Energien naturverträglich zu gestalten und sich zügig von fossiler Energie zu lösen, sagt Nabu-Landeschef Holger Buschmann. Außerdem müssten „natürliche CO2-Senken wie Moore, alte Wälder und Weidelandschaften wieder zum Leben erweckt werden“. Der BUND verweist auf die Vereinbarung zum Niedersächsischen Weg für mehr Natur- und Artenschutz. Dafür würden unter anderem mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr sowie ein baldiges, konsequentes Pflanzenschutzreduktionsprogramm benötigt.
HAUSHALT: Der Deutsche Gewerkschaftsbund erhofft sich von der neuen Regierung insgesamt mehr staatliche Investitionen. Dafür solle ein rechtlich eigenständiger Investitionsfonds, der sogenannten NFonds, geschaffen werden, sagt DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Zusammen „mit einer Landeswohnungsbaugesellschaft, einer Hochschulentwicklungsgesellschaft oder einer Infrastrukturgesellschaft“ könne damit das Land modernisiert werden. SPD und Grüne unterstützen die Idee eines NFonds, CDU und FDP sehen das kreditfinanzierte Modell kritischer.
POLIZEI: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erwartet eine bessere Bezahlung der Polizeikräfte. Dafür schwebt ihr die Anhebung der Zulage vor, die Polizistinnen und Polizisten monatlich erhalten - von 127 auf 228 Euro, wie es künftig für die Bundespolizei geplant ist. Nach Vorstellung der GdP soll die Zulage dann außerdem wieder auf die Höhe der Bezüge im Ruhestand angerechnet werden.
BERATUNG: Die Verbraucherzentrale Niedersachsen, die derzeit wegen der hohen Energiekosten besonders viele Nachfragen erreicht, fordert eine stärkere finanzielle Unterstützung ihres Angebots. Bisher liege diese pro Einwohner gerechnet unter dem bundesweiten Durchschnitt. Nur mit einer ausreichenden, planungssicheren Finanzhilfe könne Ratsuchenden unabhängig, schnell und kompetent geholfen werden. (dpa)
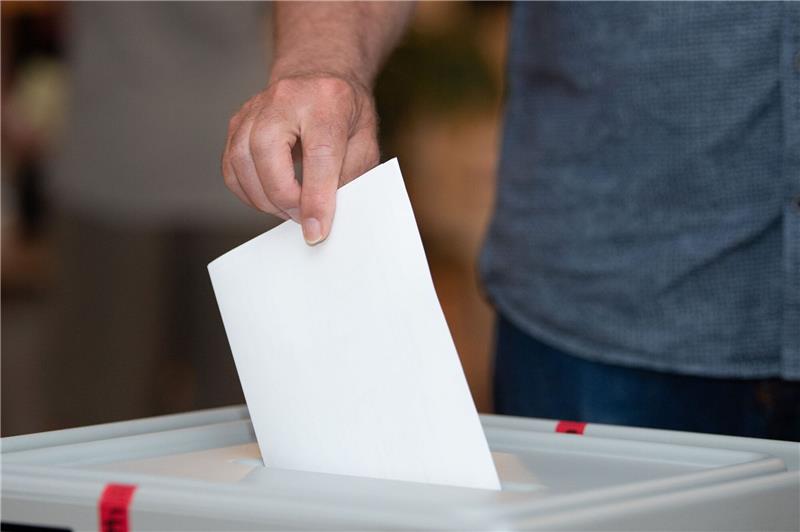
Kommt Rot-Grün? An diesem Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Foto: dpa









