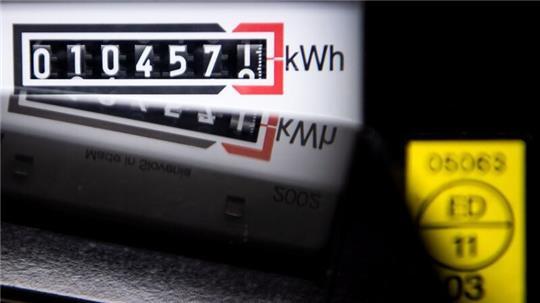Streit um Heizungsgesetz: Darauf hat sich die Ampel geeinigt

Wirtschaftsminister Robert Habeck drängt auf eine zügige Verabschiedung des Heizungsgesetzes noch vor der Sommerpause.
Mit Hilfe des Kanzlers, Vizekanzlers und Finanzministers gelingt der Durchbruch beim umstrittenen Heizungsgesetz. Der Gesetzentwurf kommt nun zu Beratungen in den Bundestag. Die Änderungen im Überblick.
Von Antje Höning und Birgit Marschall
Mit Hilfe von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Grünen-Vizekanzler Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner gelang der Ampel-Koalition am Dienstagabend ein Durchbruch im wochenlangen Streit um das Heizungsgesetz. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.
Die drei Fraktionschefs der Ampel-Parteien, Rolf Mützenich (SPD), Katharina Dröge (Grüne) und Christian Dürr (FDP) sehen erleichtert aus, als sie am Dienstagabend im Reichstag vor die Presse treten. Man habe sich auf politische „Leitplanken“ oder „Leitkriterien“ für das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG) geeinigt, berichten sie nach einer Spitzenrunde, an der überraschend auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) und FDP-Chef Christian Lindner teilgenommen hatten. Das auch als Heizungsgesetz bekannte GEG könne jetzt noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht und vor der Sommerpause im Juli beschlossen werden.
Soll es eine Umtauschpflicht für Heizungen geben?
Hier hat die FDP den Grünen einige Zähne gezogen. „Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, gelten beim Heizungstausch die Regelungen des GEG noch nicht“, heißt es in dem Leitplanken-Papier der Ampel-Fraktionen. Stadtwerke und Kommunen haben bereits angekündigt, dass sie eine Wärmeplanung - also die Planung von Fern- und Nahwärmenetzen mit detaillierten, gebäudescharfen Angaben - nicht so schnell hinbekommen. Das GEG sieht zwar weiterhin vor, dass neu eingebaute Heizungen vom 1. Januar 2024 an zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Doch die Verzahnung mit der Wärmeplanung gibt Eigentümern von Bestandsgebäuden jetzt noch für Jahre Zeit zur Umrüstung. FDP-Fraktionschef Dürr rechnete damit, dass etwa von 2028 an die kommunale Wärmeplanung so weit vorangeschritten sei, dass das GEG überall wirksam wird.
Dürfen weiter Gasheizungen in Bestands- und Neubauten eingebaut werden?
Ja. So lange es keine kommunale Wärmeplanung gibt, dürfen ab dem 1. Januar 2024 auch Gasheizungen eingebaut werden, wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind, heißt es in dem Papier. Derzeit wird mit Erdgas geheizt, künftig soll es möglichst grün hergestellter Wasserstoff richten, die Kesseltechnik ist etwas anders. Gasheizungen können beim Fehlen der kommunalen Wärmeplanung sogar in Neubauten eingebaut werden, wenn diese außerhalb von Neubaugebieten liegen. Nur in Neubaugebieten gelten die Regelungen des GEG unmittelbar ab Januar 2024.
Sind künftig Pelletheizungen erlaubt?
Auch hier hat sich die FDP durchgesetzt, die Pelletheizungen als Teil der von ihr geforderten Technologieoffenheit versteht. Die Grünen wollten Pelletheizungen eigentlich nur in Bestandsbauten erlauben. Nun sind sie auch in Neubauten möglich. So definieren die Leitplanken Pelletheizungen als gut: „Heizungen, die mit Holz und Pellets betrieben werden, erfüllen die 65-Prozent-Vorgabe ausnahmslos.“ Das heißt, sie gelten als erlaubte Heizungen, obwohl das Bundesumweltamt vom Einsatz dringend abrät. Einschränkend heißt es lediglich: „Beim Einsatz von Holz und Pellets sind Fehlanreize zu vermeiden.“
Was wird aus der Ausnahmeregel für über 80-Jährige?
Zunächst war geplant, dass über 80-Jährige nicht zum Tausch von Heizungen verpflichtet werden sollen. Die willkürliche Setzung der Altersgrenze 80 (warum nicht 70 Jahre?) hatte viel Kritik ausgelöst. Nun soll die Regelung fallen: „Wir wollen niemanden zu etwas verpflichten, das in der jeweiligen Lebenslage nicht leistbar ist. Darum werden die Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel die Regelung zur 80-Jahres-Grenze, überarbeitet und plausibler gestaltet“, heißt es in dem Leitplanken-Papier weiter. Was das konkret heißt, bleibt abzuwarten. Im Detail könnte der Streit hier also weitergehen.
Welche Förderung soll es im Fall des Heizungstauschs geben?
Haushalte dürften finanziell nicht überfordert werden, so die Ampel. „Deshalb wird es vonseiten des Bundes eine Förderung geben, die aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wird und die möglichst passgenau die einzelnen Bedürfnislagen und soziale Härten bis in die Mitte der Gesellschaft berücksichtigt“, heißt es im Papier. Bisher geplant hatte die Regierung im Normalfall eine Förderung von bis zu 30 Prozent der Investitionskosten und für kleinere Einkommen von bis zu 50 Prozent. Die Zuschüsse würden voraussichtlich angehoben, so Grünen-Fraktionschefin Dröge.
Was soll für Mieter gelten?
Vor allem der SPD war wichtig, Mieterinnen und Mieter vor deutlich höheren Belastungen zu schützen, wenn der Vermieter die Investitionskosten für eine neue Heizung auf sie überwälzt. „Bei Investitionen in eine klimafreundliche Heizung werden wir eine weitere Modernisierungsumlage unter der Voraussetzung einführen, dass eine Förderung in Anspruch genommen wird“, heißt es im Papier. Auch die Mieter sollten von dieser Förderung finanziell profitieren.