Warum jeder Arbeitnehmer im Kreis Stade heute kurz innehalten sollte
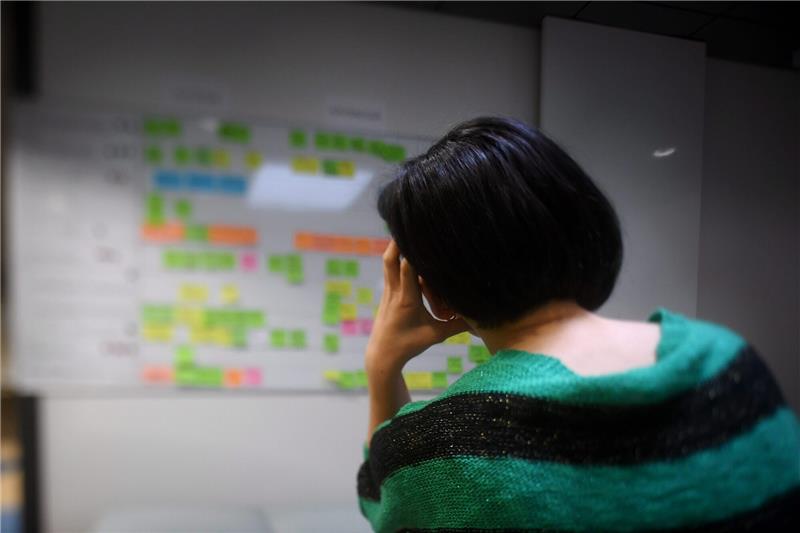
Die Krankenkasse DAK warnt vor größeren gesundheitlichen Risiken für Beschäftigte in Jobs mit ständigen Personalengpässen. Foto: dpa
Mehr Arbeit, komplexere Aufgaben, mobiles Arbeiten - der Wandel der Arbeit geht an der Gesundheit von vielen Beschäftigten oft nicht spurlos vorüber. Die Zeichen sind alarmierend.
Wenn der Job auf die Gesundheit geht: „Jeder Arbeitsplatz hat seine eigenen Tücken“, sagt Achim Bartels. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Hamburg warnt davor, die Risiken - auch die versteckten - auf die leichte Schulter zu nehmen: „Die Routine im Job darf nicht blind machen. Jeder muss wissen, wo Gefahren am Arbeitsplatz lauern und wie man sich schützen kann. Das müssen sich 91.000 Menschen im Landkreis Stade streng genommen jeden Morgen aufs Neue klarmachen.“
So viele Erwerbstätige gibt es nämlich im Kreis nach Angaben des Statistischen Bundesamtes – vom Arbeiter bis zur Angestellten, von der Beamtin bis zum Selbständigen. „Arbeits- und Gesundheitsschutz ist das oberste Gebot für alle“, sagt Bartels.
„Sicherheits-Weckruf“ im Job erinnert an Gesundheitsgefahren
Die IG Bau startet ihren „Sicherheits-Weckruf“ zum internationalen Gedenktag an die Menschen, die der Job krank gemacht hat oder die bei der Arbeit sogar getötet wurden: Der 28. April ist "Workers‘ Memorial Day". „Ob im Betrieb, auf der Baustelle oder auch im Homeoffice – am Freitag sollten die Beschäftigten um Punkt 12 Uhr eine Gedenkminute einlegen“, sagt Achim Bartels. Der "Workers‘ Memorial Day" steht nach Angaben der IG Bau in diesem Jahr unter dem Motto: „Unsichtbare Gefahren sichtbar machen“.
Dabei warnt der Bezirksvorsitzende vor „einer Fülle von versteckten Gefahren“ für die Gesundheit im Job.
Kasse warnt vor Gesundheitsrisiken bei ständigem Personalmangel
Die Krankenkasse DAK-Gesundheit warnt vor größeren gesundheitlichen Risiken für Beschäftigte in Jobs mit ständigen Personalengpässen. Vorstandschef Andreas Storm sagt: „Die Arbeitswelt steht enorm unter Druck.“ Zusammenhänge zwischen Personalmangel und Krankenstand seien größer als bisher vermutet. Dabei sei Fachkräftemangel kein Problem erst der Zukunft, sondern vielfach schon Realität.
Laut einer Umfrage für die Kasse erlebten insgesamt 45 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben regelmäßig Phasen, in denen die Arbeit mit dem vorhandenen Personal nur unter großen Anstrengungen zu schaffen war. Bei Pflegekräften und Beschäftigten in der Erziehung und Betreuung von Kindern war der Anteil demnach besonders hoch.
In Berufsgruppen mit größeren Fachkräftelücken lag der Krankenstand im vergangenen Jahr über dem Berufe-Durchschnitt von 5,5 Prozent, wie die DAK nach eigenen Versichertendaten ermittelte. So waren es in der Altenpflege 7,0 Prozent - im Schnitt waren dort also an jedem Tag des Jahres 70 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Bei Beschäftigten, die Fahrzeuge fahren, in der Kinderbetreuung sowie in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik lag der Krankenstand demnach bei 6,8 Prozent.
Viele Unternehmen sehen Burnout und Co. als wachsendes Problem
Psychische Belastungen und Burnout spielen aus Sicht vieler Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen künftig eine zunehmende Rolle. Knapp 39 Prozent der befragten Geschäftsführer und Verantwortlichen geben laut einer Studie an, dass solche Belastungen am Arbeitsplatz in ihren Unternehmen bereits heute eine große Bedeutung hätten. In drei Jahren haben demnach Burnout und Co. nach Einschätzung von sogar 70 Prozent der befragten Verantwortlichen eine große Bedeutung. Das geht aus der vorgestellten Studie des Konstanzer Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor.
Verschiedene Krisen, nötige Anpassungen an veränderte Märkte und die umfassende Digitalisierung zählten zu den psychischen Belastungsphänomenen, sagte die TK-Personalvorständin Karen Walkenhorst. Laut der Erhebung sehen rund 86 Prozent der Unternehmensverantwortlichen die schiere Menge der Aufgaben als eine aktuell große Herausforderung am Arbeitsplatz. Knapp 77 Prozent sehen die Komplexität der Aufgaben als eine solche Herausforderung.
Bei den Versicherten zählten psychische Erkrankungen ebenfalls zu den Hauptursachen für Fehlzeiten, wie Walkenhorst anhand von TK-Daten deutlich machte. Laut der Krankenkasse stiegen die durchschnittlichen Fehltage aufgrund psychischer Diagnosen bei den eigenen Versicherten im vergangenen Jahr weiter an.
Pro erwerbstätiger Person fehlten die Versicherten 2022 im Schnitt an 3,33 Tagen wegen psychischer Diagnosen, im Vorjahr waren es 3,17 Tage. Diagnosen, die auf Burnout hinweisen, führten dabei laut der Kasse bei im Schnitt 1,95 Tagen zur Krankschreibung nach 1,85 Tagen im Jahr 2021. 2012 waren es erst 1,47 Fehltage im Schnitt wegen solcher Diagnosen.
Nicht ausbrennen, weiterbrennen? Das steckt hinter einem Burn-on
Vom Burn-out haben die meisten dabei schon gehört. Doch ist man im Arbeitsleben ständig angespannt und im Dauerstress, hat man es vielleicht mit einem Burn-on zu tun.Wer sich dieser Arbeitsbelastung dauerhaft aussetzt, brennt möglicherweise für seinen Job, leidet vielleicht aber auch unter einem Burn-on.
Der Begriff wurde von dem psychologischen Psychotherapeuten Timo Schiele und dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Prof. Bert te Wildt ins Spiel gebracht. Sie haben zusammen das Buch „Burn On: Immer kurz vorm Burn Out“ verfasst.
Während Burn-out eine akute Erschöpfungsdepression beschreibt, kann Burn-on als chronische Erschöpfungsdepression verstanden werden. „Wir hatten das Gefühl, dass es sinnvoll ist, das zu beschreiben und in einen anderen Begriff zu fassen, um den Patienten besser gerecht zu werden“, sagt Bert te Wildt, der Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen am Ammersee ist. So wolle man die Patienten besser erreichen.
Unterschätzte Depression wegen der Arbeitsbelastung
„Man spricht auch von einer larvierten, also verpuppten Depression“, so Bert te Wildt. „Die Patienten machen eigentlich immer am Rande eines Zusammenbruches weiter und kultivieren damit hinter einem Lächeln eine andere Art von Erschöpfung und Depressivität.“ Daher auch der Begriff Burn-on: Während Patienten mit Burn-out zusammenbrechen und krankgeschrieben werden, funktionieren Burn-on-Betroffene immer weiter.
Bert te Wildt versteht einen Burn-on auch nicht als etwas Positives, sondern als einen Zustand, „der mit einem signifikanten Leiden einhergeht, das aber eher versteckt ist.“ Die Arbeit wird zwar noch erledigt, aber das Sozial-und Privatleben leiden deutlich - und werden nicht mehr als lust- und freudvoll empfunden. Viele Betroffene könnten ihre Liebe für die Arbeit aber nicht mit ihrer Symptomatik zusammenbringen, sagt te Wildt. Bis zur Einsicht, dass etwas nicht stimmt, können daher Jahre mit erheblichem Leidensdruck vergehen.
Was führt zum Burn-on?
Leistung und Erfolg sind in unserer Gesellschaft ein Maßstab für gesellschaftliche Anerkennung. Insbesondere in Bereichen, in denen ein hoher Zeiteinsatz auch über die reguläre Arbeitszeit hinaus belohnt wird oder als notwendige Voraussetzung für den Job gilt, sind Burn-out und Burn-on häufige Begleiterscheinungen: „Ab einem bestimmten Maß von Arbeit und Entfremdung von sich selbst ist keine Arbeit mehr gut“, sagt te Wildt.
Aber auch in Bereichen, in denen Arbeit entgrenzt oder an Beziehungsarbeit geknüpft ist, treten Burn-on-Erscheinungen vermehrt auf: etwa in Pflegeberufen, im medizinischen und therapeutischen Bereich oder bei Lehrerinnen und Lehrern. „Es sind häufig Menschen, die Verantwortung für andere Menschen haben“, so te Wildt.
Der Professor für Wirtschaftspsychologie Florian Becker sagt: „Aus meiner Sicht hat das viel damit zu tun, Grenzen zu setzen, vor allem Grenzen gegenüber anderen.“ Aber auch Menschen, die sich vor allem über Leistung definieren, zählen zu den Betroffenen. „Das sind „insecure overachiever“, die unsicheren High Performer, die leisten, aber unsicher bleiben“, so te Wildt.
Welche Symptome bringt ein Burn-on mit sich?
Während ein Burn-out mit Erschöpfung einhergeht und einer tiefen inneren Abneigung der Arbeit gegenüber, sind die Symptome beim Burn-on anders gelagert. Betroffene zeigen eine kognitive Einengung auf die Arbeit, die sich in einem Fokus auf Effektivität und Leistung äußert, auch im Privaten, berichtet te Wildt.
Auf einer emotionalen Ebene dominiert der depressive Aspekt: Obwohl Betroffene leistungsorientiert und erfolgreich sind, empfinden sie keinen Stolz für ihre Leistungen und sehen sich selbst als ungenügend. Sie haben Scham- und Schuldgefühle, obwohl sie eigentlich permanent für die Arbeit und andere Menschen da sind. „Trotz der immensen Leistung leiden die Betroffenen unter dem Gefühl, nie zu genügen“, sagt te Wildt.
Die Folge: innere Leere, Verzweiflung, Freudlosigkeit und ein Gefühl von Sinnlosigkeit. „Viele Menschen spüren gar nicht mehr ihre Grenzen, ihre Leidenschaften, ihre Interessen“, sagt Becker. „Sie können auch Erfolge nicht mehr genießen.“
Betroffene fühlen sich einerseits müde und schlapp, können gleichzeitig aber nicht zur Ruhe kommen. Auch im Urlaub sind sie mit dem Kopf noch bei der Arbeit. Körperliche Symptome reichen von Bluthochdruck, Rücken- und Kopfschmerzen bis hin zu Tinnitus und Schlafstörungen. Der Körper befindet sich im dauerhaften Stresszustand.
Was hilft?
Burn-on-Betroffene müssen sich des Problems oftmals erst bewusst werden. Und sich dann auch gezielt dafür entscheiden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wichtig sei, sich Zeiten und Räume zu schaffen, die nicht funktional gesehen werden, sondern in denen man sich emotional und körperlich angesprochen fühlt, rät te Wildt. „Ich benutze den Begriff Reservate ganz gerne, dass man sich Reservate der eigenen Menschlichkeit schafft, in denen der Arbeitsmodus nichts zu suchen hat.“
Hilfreiche Fragen könnten sein: Was passt wirklich zu mir? Was habe ich früher gerne gemacht? Was wollte ich schon immer gerne machen und was erfüllt mich mit Leidenschaft? Auch ein Wechsel zwischen Entspannungsübungen und forderndem Sport, der zu einer natürlichen Erschöpfung führt, könne helfen. Außerdem wichtig: Betroffene sollten bei der Arbeit Grenzen ziehen. „Klar „Nein“ zu sagen, ist eine sehr wichtige Kompetenz, die vielen Menschen fehlt“, sagt Becker.
Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Bert te Wildt rät: „Man muss sich fragen: Was bin ich bereit zu geben, zu leisten und was übersteigt ganz klar meine Grenzen und das dann auch zu markieren.“ Eine ambulante oder stationäre Therapie bildet hier in vielen Fällen eine notwendige Unterstützung: Dort können gemeinsam Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet werden.
Aber auch der biografische Hintergrund sollte in den Blick genommen werden, um zu verstehen, woher das Gefühl von Unzulänglichkeit und Leistungsdruck stammt - und eine Burn-on-Symptomatik nachhaltig zu verbessern. (dpa/tmn/tip)









