Zwei Paare erzählen: Wie Gleichberechtigung die Beziehung verbessert

Lena und Thomas Höter. Foto: Helfferich
Zwischen ihnen liegen gut 40 Jahre: Lena und Thomas Höter aus Dollern stehen mitten im Familienleben. Helga und Hans Schmidt aus Bützfleth hingegen genießen gemeinsam ihren Lebensabend. Welche Rolle spielt Gleichstellung in ihren Partnerschaften?
Premium-Zugriff auf tageblatt.de für nur 0,99 €
Jetzt sichern!
Lena und Thomas Höter aus Dollern haben sich von den Rollen-Vorbildern verabschiedet, mit denen sie aufgewachsen sind. In ihrer Beziehung ist alles gleichberechtigt verteilt. Ein Modell, das mit vielen Einschränkungen verbunden ist. Aber auch ein Modell das zeigt, wie weit der Weg zur Gleichstellung der Geschlechter noch ist.
Als die Tochter von Lena und Thomas Höter 2012 geboren wurde, fiel der Equal Pay Day auf den 23. März. Das bedeutet, dass Frauen in Deutschland damals 23 Prozent weniger verdient haben als Männer. Zehn Jahre später, also heute, liegt die Lücke im Verdienst immer noch bei 18 Prozent. Und vermutlich werden Lena und Thomas Höter ihrer Tochter in weiteren zehn Jahren immer noch erklären müssen, warum Frauen schlechter bezahlt werden, warum sie immer noch um ihre Rechte kämpfen müssen.
Mit Anfang 20 haben sich der Krankenpfleger und die Bankkauffrau kennengelernt. „Nach einem halben Jahr haben wir unsere Lebenspläne übereinandergelegt und gemerkt, es passt“, sagt Thomas Höter. Dann ging es schnell: Nach anderthalb Jahren Beziehung bauten sie 2007 ihr Haus in Dollern, 2010 folgte die Hochzeit, 2012 wurde ihre Tochter geboren. Gedanken über die Rollenverteilung in der Beziehung haben sie sich damals noch nicht gemacht. „Das kam mit der Zeit“, sagt Thomas Höter. Und es kam anders, als das Paar erwartet hatte.
Gleichberechtigung in Erziehung und Erwerbstätigkeit
Die Rollenbilder, die ihnen in ihrer Jugend vorgelebt wurden, haben die beiden über Bord geworfen. Der 40-Jährige stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. „Im Osten waren meist beide Elternteile Vollzeit tätig, und die Kinder wurden rundum betreut im Kindergarten oder im Hort.“ Lena Höter ist in Dollern aufgewachsen. „Meine Mutter war fast nur zu Hause und hat sich um uns Kinder gekümmert. Mein Papa war nur am Wochenende da“, erzählt die 38-Jährige, „und ich wollte es genauso machen, nur für die Kinder da sein.“ Heute leben die beiden eine Beziehung, in der sie sich alles komplett und gleichberechtigt teilen. Arbeit, Geld, Erziehung, Haushalt – jeder steuert seinen Teil dazu bei.
Vor der Geburt ihrer Tochter haben beide in Vollzeit gearbeitet und gleich viel verdient. Nach einem Jahr Elternzeit fing sie mit 30 Stunden wieder an. Dass beide berufstätig blieben, war eine Notwendigkeit: „Nur so konnten wir Familie und Einfamilienhaus stemmen“, erzählt Lena. Thomas Höter arbeitete damals als Krankenpfleger im Schichtdienst. Je nach Dienstplan morgens oder nachmittags – doch das brachte auch Unruhe ins Familienleben. Er zog die Konsequenz und wechselte in die Funktionspflege, mit regelmäßigen Arbeitszeiten. Schließlich reduzierte auch er auf 30 Stunden. Ein auch in 2022 nach wie vor noch ungewöhnlicher Weg.
84 Prozent der Teilzeit-Beschäftigten sind Frauen
Laut Statistischem Bundesamt waren 2019 in Deutschland nur 6,4 Prozent der erwerbstätigen Väter teilzeitbeschäftigt. Bei den Müttern waren es 66,2 Prozent. Im Landkreis Stade sind 84 Prozent der in Teilzeit Beschäftigen Frauen. Wie Ulrike Langer, Beauftragte von Chancengleichheit bei der Arbeitsagentur Stade, berichtet, steigen die Nachfragen von Männern nach Teilzeit sehr langsam. „Wenn die Frau einen gut dotierten Job hat, sind Männer bereit, zurückzutreten und den Kinderjob zu übernehmen.“ Ansonsten würden Teilzeit-Väter vor allem in männlich dominierten Jobs schräg angesehen.
Für ihre Tochter wünschen sich Lena und Thomas Höter, dass in zehn Jahren Gleichberechtigung nicht mehr vom Einkommen der Geschlechter abhängt und dass sie später als Mutter nicht um Unterstützung ihres Mannes bitten muss, sondern dass das gleichberechtigte Erziehen des gemeinsamen Kindes selbstverständlich ist.
Fragen, die sich ihr zweites Kind vermutlich nicht stellen muss. Denn es ist ein Junge. Nach seiner Geburt nahm Lena Höter erneut Elternzeit, stieg aber nach sechs Monaten mit 18 Stunden wieder in den Job ein, um ihren Arbeitsplatz in Buxtehude zu sichern. Später hätte sie vielleicht längere Fahrwege in Kauf nehmen müssen. Heute arbeitet die 38-Jährige 24 Stunden, einen vollen Tag und drei Tage halbtags. Neben Job und Familie macht sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin.
„Mit Lernzeit komme ich auf 30 Stunden“, sagt sie. „Wir kommen finanziell zurecht, machen keine großen Sprünge, aber wir sind glücklich“, sagt Lena. „Jeder ist gleichberechtigt in der Erziehung, weil wir beide zu Hause sind und uns um die Kinder kümmern“, sagt Thomas. Sie: „Wenn er am Wochenende oder an seinem freien Tag kocht, Hausaufgaben mit den Kindern macht und sich um den Haushalt kümmert, kann ich mich ausklinken. Da kann ich mich voll darauf verlassen.“
Gleichstellung ist echte Beziehungsarbeit
„Es kommt auch mal vor, dass ich aus Lenas Sicht etwas nicht richtig mache“, wirft Thomas ein, „dann muss ich den Mund aufmachen.“ Da wird deutlich, dass ihr Weg der Gleichberechtigung in Beziehung und Familie echte Arbeit ist: „Wir reden dann darüber und es wird wieder zurechtgebogen.“ Bei der Frage nach einer Aufgabenteilung müssen beide nachdenken. „Schon beim Hausbau habe ich mit angepackt“, sagt Lena. Manchmal sei es ja auch eine Frage der Kraft, sagt Thomas: „Wenn im Garten tiefe Löcher gebuddelt werden müssen, bestehe ich nicht darauf, dass Lena das macht. Aber ich hänge auch die Wäsche auf und sie mäht den Rasen.“
Ressentiments gegen Teilzeit-Eltern
Lena und Thomas Höter leben ein komplett gleichberechtigtes Beziehungsmodell. Ein Modell, das auch in 2022 nicht leicht umzusetzen ist. Nach wie vor gebe es gesellschaftliche und strukturelle Ressentiments, die überwunden werden müssen, findet das Paar. „Kinder zählen nicht bei der Arbeit“, sagt Thomas Höter, zeitliche Einschränkungen wegen der Kinderbetreuung würden immer noch als Schwäche wahrgenommen, der zusätzliche freie Tag wird geneidet. „Die finanziellen Einschränkungen, die wir auf uns nehmen müssen, werden dagegen nicht gesehen“, sagt er. „Oder dass es für Teilzeit-Beschäftigte kaum Aufstiegsmöglichkeiten gibt, obwohl sie wesentlich effektiver arbeiten.“
Alte Liebe – Neue Regeln
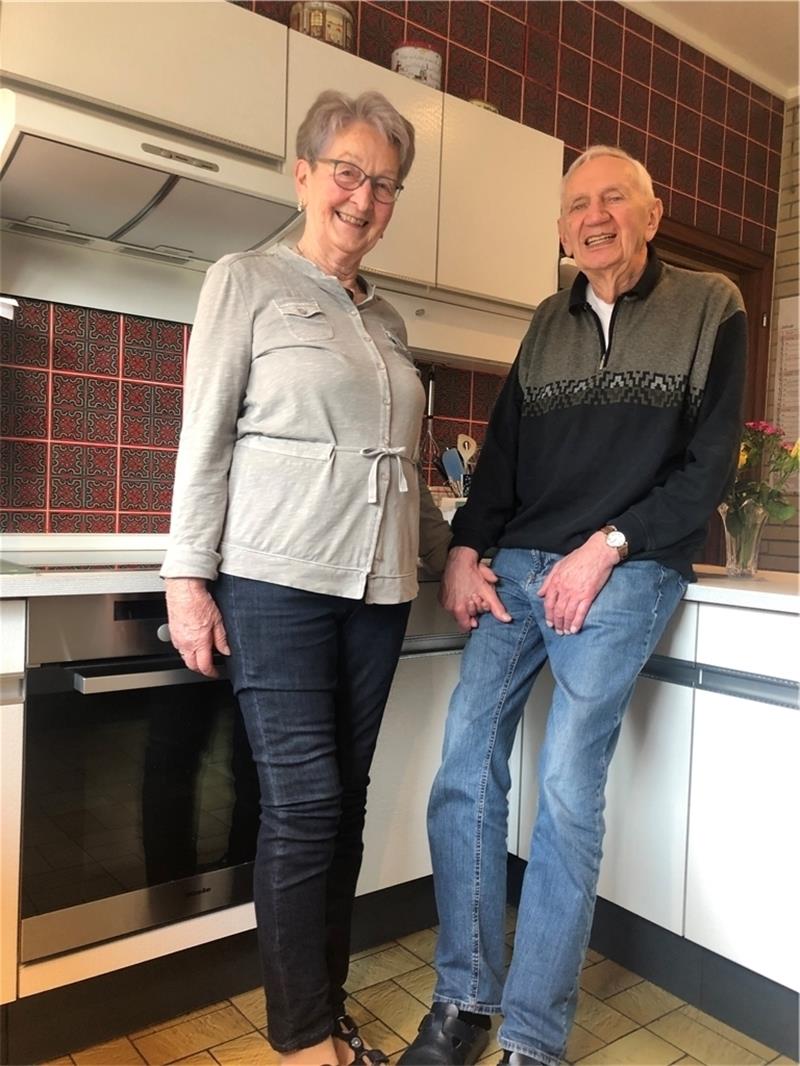
Helga und Hans Schmidt. Foto: Berlin
Nach Jahrzehnten Ehe haben Helga und Hans Schmidt aus Bützfleth ihre Rollen neu definiert. Damit konnten sie ihre Ehe retten und erfahren mehr Lebensqualität im Miteinander. Ein ungewöhnlicher Weg zu mehr Gleichstellung.
Hans Schmidt (83) sitzt in der Küche auf einem Stuhl. Er schnurrt wie ein Kater. Seine Frau Helga Schmidt (82) steht hinter ihm und massiert ihm Nacken und Schultern. Das macht sie oft, Quality-Time, so, wie es der ungewöhnliche Vertrag regelt, den Helga und Hans Schmidt vor ein paar Jahren geschlossen haben.
Die beiden haben ihre Rollen neu diskutiert – und festgelegt. Weil Helga Schmidt mehr Raum wollte, mehr Lebensqualität. Weil die Zeiten sich einfach geändert haben und eine solche Diskussion geführt werden konnte. Aber auch, weil sie damit ihre Ehe retten wollten. Denn das Rollenbild ihrer Jugend hatte das Paar in eine Sackgasse geführt.
Er ging zur Arbeit, sie kümmerte sich um Haus und Kinder
Die Rollen in der Beziehung waren immer klar verteilt. „Eindeutig“, sagen die beiden. Als er noch voll im Berufsleben stand und als Ingenieur und Berater in Sachen Holz in der ganzen Republik unterwegs war, kümmerte sie sich um den Haushalt, den Garten, die Kinder, sie kochte, putzte, machte die Büroarbeit und ging auf in ihren Ehrenämtern. Er brachte das Geld nach Hause und galt als einer der ersten Umweltaktivisten, die sich in Bützfleth auflehnten, als den Menschen dort die Industrie vor die Tür gesetzt wurde.
Sie standen kurz vor der Trennung
Die Schmidts leben seit den 70er-Jahren in Bützfleth. 1959 lernten sie sich beim Tanzen im Abbenflether Fährhaus kennen. Sie tanzten immer schon leidenschaftlich gern. Zwei Wochen später beim Schützenfest wurden sie ein Paar. 1962 haben sie geheiratet. In einer Autobiografie, die Helga Schmidt vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, beschreibt sie, dass sie ihrem Hans mit dem Ja-Wort vor Gott die Treue geschworen hat. Das ist wichtig. Denn das Paar stand in schicksalhaften Jahren kurz vor der Trennung. Aber der Schwur hält bis heute. Die beiden haben täglich an ihrer Ehe gearbeitet. Sie mussten lernen.
Helga Schmidt verlor drei Kinder. Ein Mädchen kam tot zur Welt. Ein Kind verlor sie nach wenigen Monaten der Schwangerschaft, ein Mädchen starb an einem Hirntumor. Ziemlich viele Schicksalsschläge für eine Ehe, für eine Mutter und einen Vater. Helga Schmidt trauerte offen und lange. Hans Schmidt trauerte für sich. Er verlor sich in der Arbeit für den Umweltschutz, seine Firma litt. „Ich habe mich ein bisschen verrannt“, sagt Hans Schmidt heute.
Mit Transaktionsanalyse zu sich selbst gefunden
Transaktionsanalyse ist ein sperriges Wort. Das Eintauchen in diese psychologische Theorie der menschlichen Persönlichkeitsstruktur half Helga Schmidt, sich selbst zu begreifen. Sie hat ihre Lebenswirklichkeit reflektiert, analysiert und verändert. Irgendwo versteckt steckte noch dazu ein schmerzhafter Stachel aus Helga Schmidts Kindheit.
Ihr Vater, das schrieb sie auch in ihrem Buch, habe immer zu ihr gesagt, sie sei nichts und aus ihr werde nichts. Sie sollte eigentlich der Sohn werden. Helga Schmidt lernte, sich selbst zu vertrauen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.
Ein Vertrag regelte nun das Zusammenleben
Einige davon erscheinen zunächst ganz profan. „Wir haben Verträge wie in einer WG gemacht“, sagt Helga Schmidt. Ihr Mann war nie der Macho. Er kümmerte sich um den Sohn Peter, als der noch ein Säugling war, hielt ihn, wenn er schrie, wickelte ihn, fütterte ihn. Hans Schmidt fand es unpassend, wenn ein Mann eine Frau Fräulein nannte. Und als er einmal vor Jahren ein amtliches Schreiben erhielt, in dem er als Haushaltsvorstand angesprochen wurde, musste er lachen. Aber die Verträge verschafften Helga Schmidt mehr Luft zum Atmen.
„Ich wollte nicht mehr zwischen Bügeleisen und Herd umherhetzen“, sagt Helga Schmidt. Also übernahm Hans Schmidt von fünf täglichen Mahlzeiten am Tag eine. Das Abendbrot. Heute schneiden sie gemeinsam das Gemüse und bereiten das Essen zu. Sie trinken ein Glas Wein dabei. Sie reden viel. Hans Schmidt ist aufmerksamer geworden. Der Paartherapeut und Psychologe Bernhard Ludwig sagt, dass Paare nach vier Ehejahren täglich nicht einmal vier Minuten tiefgründig miteinander sprechen. Helga und Hans Schmidt sprengen diese Statistik. Sonntagmorgens zum Beispiel nehmen sich die beiden zwei Tassen Kaffee mit ins Bett und sinnieren, was passiert ist. Der Sonntagmorgen ist längst ein Ritual geworden.
Sie musste das miteinander Streiten lernen
Helga Schmidt lernte bei der Transaktionsanalyse eine neue Diskussionsstruktur. Sie lernte das Streiten. Sie lernte, wie Worte wirken, welche Wucht sie entfalten können. „Jetzt diskutieren wir auf Augenhöhe“, sagt Helga Schmidt.
Helga und Hans Schmidt sind jetzt 60 Jahre verheiratet. Ihr Leben und ihr Zusammenleben waren voller Hürden. „Wenn wir das Elend auf der Welt sehen, ist unser Leben im Vergleich ganz normal“, sagt Helga Schmidt.
Helga und Hans Schmidt wollen noch zum Friedhof. Ihre Töchter Imke und Kerstin liegen da. Sie werden sich bei dem kleinen Spaziergang an die Hand nehmen, so machen sie das fast immer. Sie gehen gemeinsam, gleichberechtigt. So, wie die beiden es wollen. Auch ohne einen Vertrag.
Themenreihe „Perspektive“: Gleichstellung
- Teil 1: Equal Pay Day: Warum Frauen heute immer noch weniger verdienen als Männer
- Teil 2: Warum der Frauentag immer noch wichtig ist - Zwei Frauen aus dem Kreis Stade berichten
- Teil 3: Zwei Paare erzählen: Wie Gleichberechtigung die Beziehung verbessert
- Teil 4: „Ich hoffe, die Männerclubs sterben irgendwann aus“
- Teil 5: Job und Familie – „Sie hielten mich für eine Rabenmutter“
- Teil 6: Fußball-Schiedsrichterin Dana Lunkowsky kennt die Machosprüche
- Teil 7: Frauen an den Herd? Bei den Hateckes ist alles anders
- Teil 8: Wege aus der Mama-Erschöpfung nach Corona
- Teil 9: Eine Frau in Führung – Stadeum-Chefin Silvia Stolz: Wie Corona Rollenbilder zementiert hat









