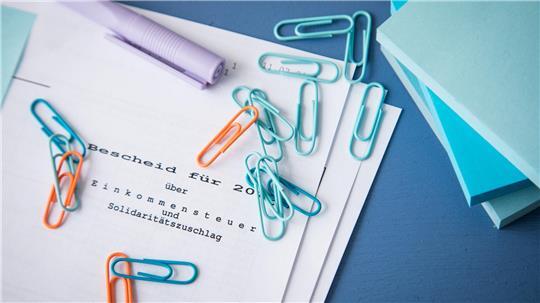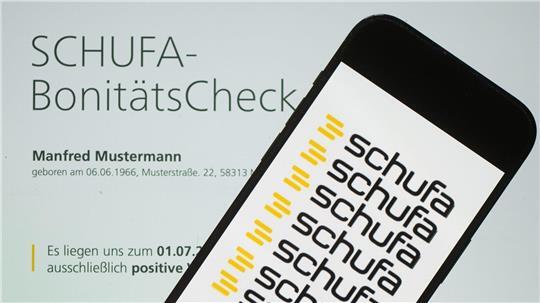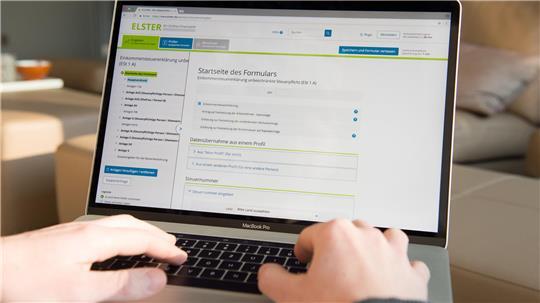Steuerbelege clever sortieren – so geht‘s stressfrei

Wohin nur mit den Belegen? Steuerlich relevante Unterlagen werden am besten schon unterjährig sinnvoll abgeheftet. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Ist bei Ihrer Steuererklärung auch regelmäßig Zettelwirtschaft angesagt? Das Problem: Wer seine Belege nicht im Griff hat, hat später unnötigen Stress. So geht‘s besser.
Jedes Jahr aufs Neue kann die Steuererklärung eine Herausforderung darstellen - insbesondere dann, wenn Unterlagen fehlen oder nicht auffindbar sind. Damit Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht kurz vor Ende der Abgabefrist in Hektik geraten, legen sie steuerlich relevante Belege schon unterjährig passend zurecht. Das spart Zeit und Stress.
Die wohl klassischste Methode ist dem Bund der Steuerzahler zufolge, die Belege in einem Aktenordner mit verschiedenen Registern oder Trennblättern zu sammeln. Beliebt ist aber zunehmend auch die digitale Ablage: Belege werden eingescannt und in einer Cloud oder auf einer Festplatte abgespeichert. Scanner-Apps können hier hilfreich sein. Wer ein Steuerprogramm für seine Steuererklärung nutzt, kann prüfen, ob es einen integrierten Belegmanager hat.
Clevere Sortierung hilft bei der späteren Arbeit
Egal, ob die Belege physisch oder digital abgeheftet werden: Wer clever für die Steuererklärung vorsortiert, spart später Zeit. So können etwa Dokumente zu verschiedenen Einkommensarten (Lohn, Rente, Miete oder Kapitalerträge) beieinander liegen, Werbungskosten wie etwa Fahrtkosten oder Aufwendungen für Fortbildungen oder Arbeitsmittel ebenfalls.
Für die „Anlage Sonderausgaben“ können Belege zu Spenden, Versicherungsbeiträgen oder der Kirchensteuer gesammelt werden, für die „Anlage Außergewöhnliche Belastungen“ Krankheits- und Pflegekosten und für die „Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen“ die Rechnungen für die Reinigungskraft, Handwerkerkosten oder an Dienstleister vergebene Gartenarbeiten oder Reparaturen.
Sinnvoll ist zudem, digitale Belege eindeutig zu benennen, damit ohne Öffnen der Datei klar ist, um welchen Beleg es sich handelt. E-Mails mit benötigten Nachweisen können im Mail-Programm zudem in separate Ordner abgelegt werden.
Kurze Aufbewahrungspflicht für Privatpersonen
Gut zu wissen: Die Belege müssen der Steuererklärung nicht mehr beigefügt werden. Sie helfen lediglich bei der Erstellung der Steuerklärung und müssen nur auf Nachfrage des Finanzamts nachgereicht werden.
Zudem sind Privatpersonen nicht dazu verpflichtet, Steuerunterlagen dauerhaft aufzubewahren. „Jedoch empfiehlt es sich nach der Abgabe der Steuererklärung die Steuerunterlagen mindestens vier Jahre lang aufzubewahren“, so Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler.
Steuererklärung aufschieben? So kommen Sie ins Tun
Egal, ob die Abgabefrist im Mai, Juli oder September endet: Einige Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schieben die Bearbeitung und Abgabe ihrer Steuererklärung bis zum letzten Moment auf. Warum ist das eigentlich so, wollen wir von Verhaltensökonom und Buch-Autor Thomas Mathar im Interview wissen.
Herr Mathar, warum sind Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bei der Abgabe ihrer Steuererklärung mitunter spät dran?
Thomas Mathar: Generell neigen Menschen dazu, unangenehme oder komplexe Aufgaben aufzuschieben - ein klassisches Beispiel für Prokrastination. Rein ökonomisch oder rational betrachtet, wäre es logisch, die Steuererklärung frühzeitig zu erledigen und vielleicht sogar eine Rückzahlung zu erhalten.
Doch aus verhaltenswissenschaftlicher Perspektive wissen wir ein paar der folgenden Basics:
- Erstens: Komplexität schreckt ab. Viele empfinden das Steuersystem als undurchsichtig und haben Angst, Fehler zu machen.
- Zweitens: Die fehlende kurzfristige Belohnung trägt nicht gerade zur Motivation bei. Der Aufwand für die Steuererklärung liegt in der Gegenwart, die Rückzahlung - wenn überhaupt - erst in der Zukunft.
- Drittens: Es gibt keinen sozialen Druck. Ob man die Steuererklärung früh oder spät abgibt, sieht niemand.
- Und viertens: Solange es nicht drängt, gibt es keinen Handlungsimpuls. Erst der Druck zum Stichtag hin sorgt für Bewegung.
Woher rührt der Horror vor der Steuererklärung und wie kann man ihm begegnen?
Mathar: Die Abneigung ist oft emotional geprägt und basiert auf alten Erfahrungen oder falschen Annahmen. Ein neuer Blick kann helfen:
Anstatt zu sagen „die Steuererklärung ist schrecklich, aber notwendig“, könnte man sich fragen: „Wie gut könnte es sich anfühlen, wenn sie erledigt ist?“ Statt den Fokus auf den bürokratischen Aufwand zu legen, könnte man die Steuererklärung als jährlichen Finanz-Check-up betrachten – als eine Möglichkeit, mehr Kontrolle über die eigene finanzielle Situation zu gewinnen.
Wie schaffen es Betroffene konkret, die unliebsame Bürokratie schon früher im Jahr hinter sich zu bringen?
Mathar: Man kann zum Beispiel versuchen, verschiedene Motivationsmethoden anzuwenden - die Erstellung der Steuererklärung zum Beispiel mit einer angenehmen Aktivität zu verknüpfen, etwa dem Verzehr eines Stück Kuchens, das man sich normalerweise nicht gönnen würde. Oder man belohnt sich nach jeder abgeschlossenen Sektion mit einer Pause.
Möglich ist auch, die Aufgabe in kleine Schritte aufzuteilen - also etwa nicht gleich die gesamte Steuererklärung zu machen, sondern als ersten Schritt zunächst nur die Belege zu sammeln. Zudem kann es hilfreich sein, sich mit einer Freundin oder einem Partner zu verabreden und sich das Ziel zu setzen, sich zusammen eine Stunde ranzusetzen.
Steuererklärung
Diese 9 Dinge kann fast jeder von der Steuer absetzen
Gleichberechtigung
Equal Pay Day: So werden Frauen finanziell unabhängig
Und, was ebenfalls anspornen kann: Das Wissen darum, dass schon viele Menschen im eigenen Umfeld die Steuererklärung abgegeben haben. Wir Menschen sind soziale Wesen und orientieren uns deshalb an sozialen Normen – wenn wir erfahren, dass die Mehrheit sich auf eine bestimmte Weise verhält, wollen wir dazugehören.
Kurzum: Anstatt sich nur von Strafen - wie etwa Verspätungszuschlägen - unter Druck setzen zu lassen, sollten wir Wege finden, die Steuererklärung so zu gestalten, dass sie sich einfacher, lohnender und weniger abschreckend anfühlt.
Zur Person: Dr. Thomas Mathar leitet seit 2017 das Zentrum für Verhaltensforschung bei Aegon UK, einem britischen Anbieter von Investitions- und Finanzdienstleistungen. Hier untersucht er in großen Studien die Instinkte, Motivationen, Fähigkeiten und Umweltfaktoren, die Menschen dazu bringen – oder davon abhalten –, langfristig bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.