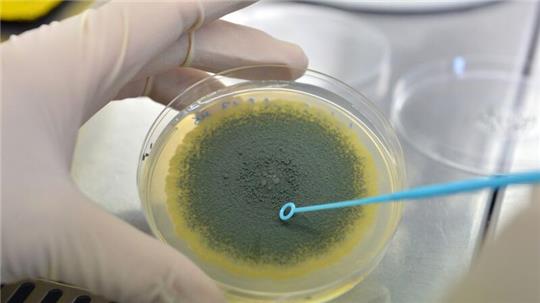100.000 E-Ladesäulen soll es bis 2030 in Niedersachsen geben

Ein Elektroauto wird an einer Ladesäule geladen.
Obwohl noch längst nicht alle Autofahrer von dieser Antriebstechnik überzeugt sind, wechselt die Elektromobilität Stück für Stück auf die Überholspur.
Von Lars Laue
1,5 Millionen Elektroautos – so lautet der niedersächsische Beitrag zum Klimaziel der Bundesregierung von 15 Millionen E-Fahrzeugen bis zum Jahr 2030.
Derzeit sind in Niedersachsen laut Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr etwa 115.000 vollelektrische Autos unterwegs. Das sind 2,3 Prozent aller Autos im Land (Bund: 2,2 Prozent). Das bedeutet: Die E-Flotte in Niedersachsen muss sich mehr als verzehnfachen, und auch die Zahl der öffentlichen Ladepunkte muss entsprechend mitwachsen. Rund 8.500 öffentliche Ladesäulen sind es derzeit, etwa 100.000 müssen es werden - zusätzlich zu den privaten Ladepunkten zu Hause oder bei Unternehmen.
Dass das nur in Zusammenarbeit mit den Kommunen gelingen kann, weiß auch Frank Doods. „Die Kommunen halten den Schlüssel hierfür in der Hand. Sie wissen, wo Ladepunkte entstehen sollten, steuern Bauplanung und -genehmigung und pflegen direkte Verbindungen zu Investoren und zum Netzbetreiber“, erklärt der Staatssekretär im Verkehrsministerium in Hannover und versichert: „Wir als Land lassen die Kommunen damit nicht allein.“ Kostenlose Beratung und konkrete Unterstützung – auf diesen beiden Säulen ruhe die Landeshilfe derzeit.
Detaillierte Ausbaukonzepte werden in vielen Kreisen entwickelt
„Um flächendeckend die Voraussetzung für Elektromobilität zu schaffen, stehen unsere Beraterinnen und Berater den Landkreisen und Kommunen unterstützend zur Seite“, betont Eric Oehlmann, Präsident der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. 13 von 45 Landkreisen und kreisfreien Städten arbeiteten bereits fest mit der Landesstraßenbaubehörde zusammen. Der Fortschritt in den einzelnen Landkreisen sei zwar unterschiedlich. „Doch schon jetzt haben wir das Ziel von 10.000 neuen Standorten für Ladeinfrastruktur in Sicht“, sagt Oehlmann. Neun weitere Landkreise hätten erste Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde geführt, und sechs Landkreise seien auf eigene Kosten aktiv geworden. Oehlmann: „Damit ist mehr als die Hälfte der Landkreise dabei, detaillierte Ausbaukonzepte zu entwickeln.“
Shivam Tokhi, Elektromobilitätsmanager bei der Landesstraßenbaubehörde, erläutert das kostenlose Beratungspaket seiner Behörde für die Kommunen. „Die Beratung sieht vor, gemeinsam die erforderliche Ladekapazität anhand des Ladebedarfs im Jahr 2030 zu ermitteln, Standorte für Ladepunkte zu identifizieren und die nötige Netzabdeckung zu klären.“
Niedersachsen hatte im Jahr 2021 als erstes Bundesland die Beratung der Kommunen aufgenommen. Ziel ist es, den Ladeinfrastrukturausbau in den Kommunen mit Hilfe von Elektromobilitätsmanagern des Landes mit einem strategischen Plan zu versehen. Im Zuge der Beratung entsteht ein immer genauerer Überblick über den Ausbaubedarf in Niedersachsen - bis hinunter auf einzelne Ortsteile. Gleichzeitig erfährt die Landesstraßenbaubehörde, welche konkreten Ausbauprobleme vor Ort auftreten und wo Ansatzpunkte für mögliche landeseinheitliche Lösungen liegen.
Knapp 3.000 Mitarbeiter sind für die Landesbehörde tätig
Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist mit Niederlassungen in ganz Niedersachsen vertreten: 13 regionale Geschäftsbereiche mit 56 Straßenmeistereien kümmern sich um die heimische Infrastruktur. Das sind rund 162.00 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, mehr als 9.000 Kilometer Radwege und etwa 5.600 Brückenbauwerke. Knapp 3.000 Mitarbeiter sind für die Landesbehörde tätig. Rund 500 Millionen Euro hat die Landesbehörde im Jahr 2022 eigenen Angaben zufolge in den Bau und Erhalt der Infrastruktur investiert. (axt)
Standpunkt: Auch Autohersteller sind jetzt gefordert
Von Lars Laue
Die Zahl der vollelektrischen Autos und Plug-in-Hybride wächst in Niedersachsen so stark, dass der Ausbau des öffentlichen E-Ladenetzes kaum hinterherkommt.
Das ist einerseits ein gutes Zeichen: Elektroautos stoßen auf immer mehr Akzeptanz und spielen gerade auf Kurzstrecken ihre Vorzüge aus. Andererseits macht die Entwicklung auch ein Dilemma deutlich: Wer die Elektromobilität im Land vorantreiben will, muss auch die nötige öffentliche Ladeinfrastruktur schaffen. Schließlich hat längst nicht jeder eine Solaranlage auf dem Dach und eine eigene Ladestation in der Garage.
Da ist es ein guter und richtiger Ansatz, dass das Land die Kommunen vor Ort kostenlos dabei unterstützt, ein dichtes Netz an Ladesäulen aufzubauen. 1,5 Millionen Elektroautos sollen bis zum Jahr 2030 auf Niedersachsens Straßen rollen, aktuell sind es etwa 115.000. Gleichzeitig soll die Zahl der öffentlichen Ladepunkte bis 2030 von jetzt 8.500 auf 100.000 anwachsen. Keine leichte Aufgabe, aber es ist zwingend, sie zu bewältigen, wenn die Ladeinfrastruktur nicht zu einem Nadelöhr der Elektromobilität werden soll. Damit die Verkehrswende ein Erfolg wird, müssen gleichzeitig die Autohersteller weiter ihre Hausaufgaben machen. Für Langstrecken sind E-Autos nach wie vor kaum geeignet. Haben sie - wie jetzt im Sommer nicht unüblich - eine vier- oder fünfköpfige Familien samt Gepäck an Bord und eine Dachbox obendrauf oder sollen womöglich noch einen Wohnwagen hinter sich herziehen, macht die Batterie des E-Mobils schnell schlapp.
Bis der Elektroantrieb eine wirkliche Alternative zum sparsamen Diesel mit Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern ist, haben die Ingenieure der Autobauer noch einiges zu tun. Es heißt, das Problem mit dem Aktionsradius werde bald gelöst sein. Hoffentlich.