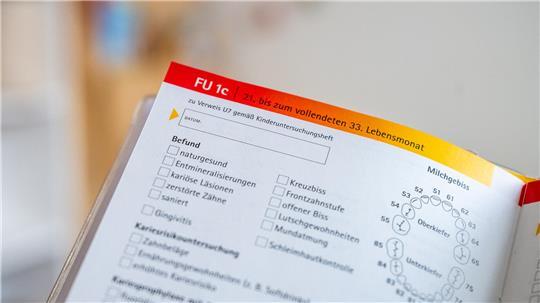Zecken schon aktiv: „Können uns nirgendwo mehr richtig sicher sein“

Viele Zeckenarten sind bedeutende Krankheitsüberträger. Foto: Marijan Murat/dpa
Experten warnen vor Infektionen und erklären ganz Deutschland zum Verbreitungsgebiet – auch wenn die Gefahr im Süden größer als im Norden ist. Die vergangenen Monate boten beste Bedingungen zum Überleben. Wo Zecken lauern.
Infolge des anhaltend milden Wetters sind die Zecken hierzulande bisher gut durch den Winter gekommen und schon sehr aktiv. „Es gibt keine Winterpause mehr. Ich habe bereits Proben erhalten, es gibt schon erste Infektionen. Die Zecken sind also schon früh dabei“, warnte Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim in Stuttgart.
Bei einem Vorlauf von etwa vier Wochen bis zur Diagnose einer übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) müssen sich die Betroffenen demnach mitten im Winter infiziert haben.
Das laufende Jahr könne ein ausgeprägtes Zecken-Jahr werden, sagte Mackenstedt. Die Forschung identifiziere auch - vor allem in Baden-Württemberg - immer mehr sogenannte Naturherde: räumlich begrenzte Gebiete mit Zecken, die den FSME-Erreger in sich tragen.
„Ganz Deutschland ist ein Endemie-Gebiet für FSME geworden, mit deutlichen regionalen Unterschieden“, so Mackenstedt. Sie warnte: „Wir können uns nirgendwo mehr richtig sicher sein.“
Zecken-Biss: Erste Symptome
Zecken übertragen in Deutschland neben FSME etwa auch die Lyme-Borreliose. Erstes Symptom der Borreliose ist oft eine größer werdende Rötung um die Einstichstelle herum, später können Nerven, Gelenke und Herz von den Bakterien befallen werden. Die meisten Infektionen verlaufen ohne Symptome.
Eine FSME geht auf Viren zurück. Die meisten Infektionen verlaufen auch hier ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei Menschen über 60 Jahren deutlich erhöht. In der ersten Phase gibt es häufig grippeähnliche Symptome, später kann eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute oder des Rückenmarks folgen. Bleibende Spätfolgen sind möglich.
Hohes Risiko vor allem in Süddeutschland
In Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer FSME-Infektion nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts nach einem Zeckenstich bei 1 zu 50 bis 1 zu 100. Ein Infektionsrisiko besteht laut RKI vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und seit dem Vorjahr auch im südöstlichen Brandenburg. Hinzu kommen einzelne Risikogebiete in anderen Bundesländern. In solchen Gebieten empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine FSME-Impfung.
FSME-Infektionen bei Menschen sind in Deutschland meldepflichtig. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Fälle in Deutschland zwar nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von 627 Fällen im Jahr zuvor auf 527 Fälle gesunken. In Baden-Württemberg gingen die FSME-Fälle von 209 auf 143 zurück, in Bayern waren es nach 291 Fällen noch 265. Experten warnen aber vor einem langfristigen Aufwärtstrend, früheren Infektionen und einer deutlich höheren Infektionsrate als bislang angenommen. Viele FSME-Infektionen würden bisher nicht als solche erkannt.
Hohe Dunkelziffer bei Infektionen
Professor Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München, hat im badischen Ortenaukreis Blutproben von Blutspendenden untersucht. Mit einem neuen Testverfahren kann er zwischen Antikörpern aus einer Impfung und aus einer Infektion unterscheiden. Das Ergebnis hat ihn überrascht: „Wenn man die nicht erkannten Infektionen einbezieht, ist das Risiko einer FSME-Infektion in dem Kreis um ein siebenfaches höher als bisher angenommen“, sagte Dobler. „Das Infektionsgeschehen ist also sehr hoch, auch wenn eine Infektion nicht immer zur Erkrankung führt.“
Wo lauern Zecken?
Anders als häufig angenommen lassen sich die achtbeinigen Spinnentiere nicht von Bäumen fallen, auch springen können sie nicht. Sie sitzen vielmehr auf Grashalmen, im Gebüsch oder auf Totholz. Kommt ein Tier oder ein Mensch vorbei, werden sie bei Kontakt abgestreift und halten sich fest. Die meisten Zecken warten laut RKI in einer Höhe von weniger als einem Meter, häufig sogar nur zwischen 10 und 50 Zentimeter über dem Boden.
Experten raten dazu, sich von Frühjahr bis Herbst in freier Natur vor Zecken zu schützen. Meist reichen schon einfache Mittel wie langärmelige Hemden, lange Hosen, feste Schuhe und Socken. Günstig ist es, sich die Socken über die Hosenbeine zu ziehen. Dann können die Parasiten deutlich schwerer Hautstellen finden, zustechen und Blut saugen. Es gibt zudem - ähnlich wie gegen Mücken - chemische Abwehrmittel, die zeitlich beschränkt wirken.
Nach einem Spaziergang in freier Natur, vor allem abseits breiter Wege, ist es zudem immer ratsam, sich selbst und vor allem Kinder nach Zecken abzusuchen, heißt es beim RKI. Die Parasiten setzen sich besonders gern in die weichere Haut von Arm- und Kniebeugen, unter Achseln, am Haaransatz oder im Genitalbereich.
Wandern im Zuge des Klimawandels neue Zeckenarten ein?
Ja. In Deutschland verbreitet sich zum Beispiel die ursprünglich hauptsächlich in den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Süd-Europas beheimatete Zeckenart Hyalomma rufipes. Die bis zu zwei Zentimeter große Riesenzecke profitiert von den milderen Wintern. Anders als der Gemeine Holzbock braucht sie kaum Wasser, hat Augen und verfolgt aktiv potenzielle Opfer - wohl bis zu etwa 100 Meter weit. Vor allem aber kann diese Art schlimme Krankheiten übertragen: Krim-Kongo-Fieber und Zecken-Fleckfieber. In Deutschland spielen solche Infektionen bisher aber keine Rolle.
Weltweit sind über 900 Zeckenarten bekannt, in Deutschland sind inzwischen mehr als 15 Arten heimisch. (dpa)