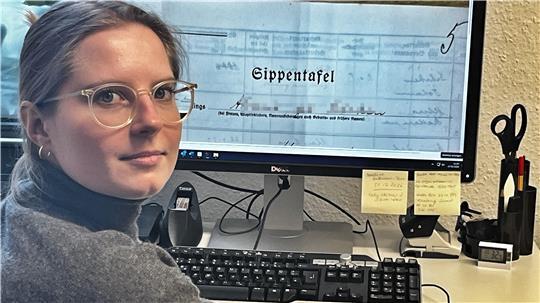Betrunkene Jugendliche auf Pfingstmarkt: Stadt Buxtehude und Polizei verschicken Warnung

Polizei, Rettungsdienst und auch DRK sind auf dem Pfingstmarkt in Neukloster im Dauereinsatz, auch weil betrunkene Jugendliche für Probleme sorgen (Symbolbild). Foto: Weselmann
In knapp einem Monat ist es soweit: Der Pfingstmarkt lockt wieder nach Neukloster. Das Fest sorgt allerdings auch für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein Problem: zu viel Alkohol.
Landkreis. Für Trubel sorgt vom 18. bis 20. Mai der 125. Pfingstmarkt in Neukloster, danach schließt sich mit dem Altstadtfest vom 7. bis 9. Juni gleich die nächste Sause in Buxtehude an. „Leider werden diese Feste immer wieder von negativen Begleiterscheinungen, wie dem übermäßigen Alkoholkonsum von Jugendlichen, geprägt“, bedauern Hansestadt Buxtehude und das Polizeikommissariat Buxtehude in einem gemeinsamen Elternbrief am Montag.
Polizei und Rettungsdienste seien mittlerweile auf Pfingtmarkt und Altstadtfest im Großeinsatz, da immer mehr betrunkene Jugendliche Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen begingen. Oder aber die alkoholisierten Teenager selbst würden Opfer Dritter.
Die Stadt Buxtehude und die Polizei kündigen auch für dieses Jahr wieder Kontrollen an, um Zuwiderhandlungen und Verstößen vorzubeugen beziehungsweise diese zu verhindern.
Polizei und Stadt geben Tipps zum richtigen Umgang mit Alkohol:
Ab wann dürfen Jugendliche Alkohol trinken?
- Unter 16 Jahren: Jugendliche dürfen in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken.
- Zwischen 16 und 17 Jahren: Jugendliche dürfen Bier, Wein und Sekt, aber keine branntweinhaltigen Getränke zu sich nehmen. Dazu zählen zum Beispiel Alkopops oder auch selbst hergestellte Mischungen mit Korn oder Wodka in Limonadenflaschen oder Tetra-Packs.

Der Pfingstmarkt aus der Luft. Wird das eigene Kind betrunken aufgegriffen, müssen Eltern es abholen. Foto: Martin Elsen
Was passiert, wenn mein Kind betrunken von Polizei und Co. erwischt wird?
- Eltern müssen ihr Kind abholen: Sollte das Kind von Behörden alkoholisiert aufgegriffen werden, müssen Eltern es abholen. Sollten die Eltern dazu nicht in der Lage sein, können ihnen anfallende Kosten für diesen Einsatz in Rechnung gestellt werden, warnen Polizei und Stadt.
Was können Eltern im Vorwege tun?
- Aufklärung: Eltern sollten mit ihren Kindern ins Gespräch kommen und sie über die Gefahren des übermäßigen Konsums von Alkohol aufklären. Eltern sollten mit ihrem Kind vereinbaren, wie mit Alkohol in der Öffentlichkeit umgegangen werden soll. „Bleiben Sie dabei klar und eindeutig in Ihrer Haltung“, sagen Polizei und Stadt.
- Gemeinsame Absprachen: Die gemeinsame Absprache mit weiteren Eltern sorgt für sichere Veranstaltungen.
- Ausweis: Das Kind muss sich bei einer Kontrolle ordnungsgemäß ausweisen können (Personalausweis), besonders im Hinblick auf die Altersbeschränkungen.
Hier gibt es weitere Informationen zu den Jugendschutzbestimmungen:
• www.polizeifuerdich.de/worum-gehts-hier/jugendschutz.html
• www.kenn-dein-limit.de/alkohol/informationen-fuer-eltern/

Ein Mädchen trinkt aus einer Flasche Wodka. Foto: Silas Stein/dpa
Jugendliche haben keine Lust mehr zum Komasaufen
Über Jahre sorgen immer wieder Fälle von Komasaufen unter Kindern und Jugendlichen für Aufsehen - jetzt haben sie offensichtlich keine Lust mehr dazu. Nach einer Studie der Kaufmännischen Krankenkasse KKH ist die Zahl der Alkoholvergiftungen unter den 12- bis 18-Jährigen 2022 auf ein Rekordtief gesunken.
In dem Jahr seien bundesweit hochgerechnet rund 10.680 Kinder und Jugendliche der Altersgruppe wegen einer akuten Alkoholvergiftung in einer Klinik behandelt worden, teilte die Krankenversicherung mit. Das seien fünf Prozent weniger als 2021 - und sogar 13 Prozent weniger als 2020. Und im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 mit rund 17.950 Betroffenen sank die Zahl um immerhin 40,5 Prozent. Damit gaben die Fallzahlen bei stationär behandeltem Alkoholkonsum von Heranwachsenden nicht nur das dritte Jahr in Folge nach, sondern erreichten auch den niedrigsten Stand seit der ersten Erhebung von 2006. Die meisten jugendlichen Rauschtrinker mit Alkoholvergiftung, nämlich hochgerechnet rund 22.260 Fälle, registrierte die Krankenkasse 2012.
Die Krankenkasse wertete den Angaben zufolge Daten der eigenen 12 bis 18 Jahre alten Versicherten zur stationären Behandlung einer akuten Alkoholvergiftung aus - und rechnete die Ergebnisse mit Hilfe von Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf die bundesweite Bevölkerungszahl dieser Altersgruppe hoch.
Anzahl der jugendlichen Rauschtrinker mit Alkoholvergiftung sinkt
Das heißt: Nach den Daten der eigenen Versicherten der Kasse lag der Anteil aller Betroffenen einer stationär behandelten Alkoholvergiftung 2022 bei knapp 0,07 Prozent. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung von über 84 Millionen Menschen sind das über 58.000. Der Anteil der 12- bis 18-Jährigen daran lag laut den Ergebnissen bei den eigenen Versicherten bei knapp 18,4 Prozent - so kam die Kasse auf die bundesweit rund 10.680 Fälle, unter den eigenen Versicherten waren es 212. Die KKH zählt nach eigenen Angaben mit rund 1,6 Millionen Versicherten zu den größten bundesweiten Krankenkassen.
Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der Anteil der Jugendlichen unter den Betroffenen der Studie zufolge noch bei über 22 Prozent, 2008 und 2009 sogar bei gut 26 Prozent, zu Beginn der Erhebung im Jahr 2006 waren es über 24 Prozent. Als Rauschtrinken definiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) den Konsum von mindestens fünf alkoholischen Getränken etwa bei einer Party.
„Jeder Jugendliche mit einer akuten Alkoholvergiftung ist einer zu viel“
„Es ist sehr erfreulich, dass offenbar immer weniger Jugendliche ihr Limit in Sachen Alkohol derart überschreiten“, sagte die KKH-Psychologin Franziska Klemm. Grund zur Entwarnung gebe es aber dennoch nicht, denn die Zahlen blieben besorgniserregend: „Jeder Jugendliche mit einer akuten Alkoholvergiftung ist einer zu viel“, betonte sie.
Beim Rauschtrinken, Komasaufen oder Binge-Drinking spielten oft soziale Motive und Gruppendruck eine Rolle. Außerdem wird Alkohol in der Gesellschaft ihren Worten zufolge immer noch verharmlost - schließlich mache er vermeintlich lustig, bringe gute Laune und vermittele Selbstvertrauen. Beim Hochprozentigen gehe es für Minderjährige aber auch um den Reiz des Verbotenen. Nach früheren Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen wird in Deutschland immer noch deutlich mehr Alkohol getrunken als im weltweiten Durchschnitt. Alkohol als vermeintliches Kulturgut sei gesellschaftlich breit akzeptiert.
„Gerade für Heranwachsende ist exzessiver Alkoholkonsum hochgefährlich“
Das Problem: „Gerade für Heranwachsende ist exzessiver Alkoholkonsum hochgefährlich und mit besonderen Risiken für eine gesunde Entwicklung verbunden“, erklärte Klemm. Neben einer möglichen Alkoholsucht drohten Schäden an Gehirn und Organen, aber auch Unfälle und Gewalt. Zu Jahresbeginn hatte sich der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, dafür ausgesprochen, dass Jugendliche ab 14 Jahren auch in Begleitung ihrer Eltern keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken dürfen - was in Deutschland erlaubt ist: „Wenn Kinder und Jugendliche neben ihren Eltern sitzen, ist und bleibt die Wirkung von Alkohol dieselbe und katastrophal in diesem Alter.“ (fe/pm/mit dpa)