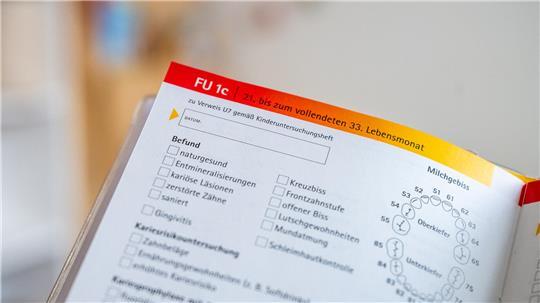Stadt oder Land? Hier gibt es mehr Herzinfarkte

Auf dem Land in Deutschland sterben mehr Menschen ab 65 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts als in der Stadt. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Die Sterbezahlen einer Langzeitstudie sind alarmierend und mit einer konkreten Forderung verbunden. Was beklagt wird und wie Sie Ihr Herzalter bestimmen können.
In Deutschland sterben in ländlichen Regionen mehr Menschen an einem Herzinfarkt als in Städten. Anders als vielfach angenommen liegt das jedoch wahrscheinlich nicht an einer schlechteren notfallmedizinischen Versorgung, sondern daran, dass anteilig mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden, wie aus einer aktuellen Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) in Rostock hervorgeht.
„Bezogen auf den Herzinfarkt können wir sagen, dass das Kernproblem des Stadt-Land-Gefälles nicht darin liegt, dass der Rettungswagen zu lange braucht, um ins Krankenhaus zu kommen, sondern dass die Krankheitsprävention auf dem Land verbessert werden muss“, sagte der MPIDR-Forscher Marcus Ebeling.
Das Forschungsteam hatte Daten auf Kreisebene ausgewertet, die Krankenhauseinweisungen, ursachenspezifischen Todesfälle und Bevölkerungszahlen für die deutsche Gesamtbevölkerung der Jahre 2012 bis 2018 und die Altersgruppe 65+ enthalten. Ländliche Gebiete in Deutschland weisen demnach in allen Altersgruppen ab 65 Jahren eine systematisch höhere Herzinfarktsterblichkeit auf.
Mehr Herzinfarkte auf dem Land - Prävention verbessern
Vorangegangene Untersuchungen hätten gezeigt, dass Rettungswagen gerade auf dem Land zunehmend später kommen, erläuterte Ebeling. „Beim Herzinfarkt ist die Überlebenswahrscheinlichkeit eng mit sofortiger medizinischer Behandlung verknüpft.“ Vermutet wurde daher ein Zusammenhang.
Bereitschaftsdienst
T Fehlende Ärzte: Praxissterben gefährdet jetzt auch die Notfallversorgung im Kreis Stade
Überlastete Notaufnahmen
T Anrufe bei ärztlichen Notfällen: Das soll sich ändern
Unter Landbewohnern kämen Herzinfarkte anteilig häufiger vor - systematische Unterschiede bei der Sterblichkeit gebe es hingegen nicht, hieß es nun. Die höhere Totenzahl erkläre sich also vor allem aus der höheren Zahl von Herzinfarkt-Patienten. Womöglich lasse sich das auf Unterschiede in der medizinischen Versorgung von Risikofaktoren des Herzinfarkts zurückführen, so das Forschungsteam. Ziel müsse eine Verbesserung der Prävention in ländlichen Regionen sein.
Notfall: Ein Herzinfarkt schmerzt oft nicht nur im Brustkorb
Typisch für einen Herzinfarkt sind laut der Deutschen Herzstiftung starke Schmerzen, die länger als fünf Minuten dauern. In aller Regel sitzen sie im Brustkorb, oft hinter dem Brustbein. Der Schmerz wird von Betroffenen etwa als brennend oder drückend beschrieben. Oft haben sie das Gefühl, dass ihnen in der Brust ganz eng ist.
Doch es ist oft nicht nur der Brustkorb: Auch Schmerzen zwischen den Schulterblättern oder im oberen Teil des Bauches können auf einen Herzinfarkt hindeuten. Und oft tun auch Arme oder Hals weh, weil die Schmerzen ausstrahlen.
Wichtig zu wissen: Ein Herzinfarkt kann sich ganz unterschiedlich äußern. Bei Älteren etwa ist der Brustschmerz möglicherweise weniger ausgeprägt, so die Deutsche Herzstiftung.
Bei Frauen können auch Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Schwitzen auf einen Herzinfarkt hindeuten - übrigens auch ohne den starken Schmerz im Brustraum.
Risikorechner: So bestimmen Sie per App das Herzalter
Das Herz kann dabei älter sein als das tatsächliche Alter. Den das Organ wird neben der erblichen Veranlagung und Umweltfaktoren vom Lebensstil beeinflusst. Und davon abhängig steigt oder sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie es genau um Ihr Herz steht, versucht die „HerzFit-App“ der Deutschen Herzstiftung zu analysieren.
Integriert ist ein von Herzspezialisten entwickelter Risikorechner, mit dem das Herzalter bestimmt werden kann. Ein schlechtes Ergebnis bedeute nicht, dass man dem Herzinfarkt oder Schlaganfall hilflos ausgeliefert sei, erklärt der Kardiologe Prof. Heribert Schunkert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.
Aber es sollte als Aufforderung betrachtet werden, etwas für die Gesundheit zu tun.
Entsprechende Expertentipps gibt es dann auch gleich in der App.
Neben Informationen zu mehr Bewegung und einer gesunden Ernährung gibt es Strategien zur Bewältigung von Stress und zum Aufhören mit dem Rauchen.
Nach Angaben der Herzstiftung fragt die App persönliche Gesundheitsdaten wie Blutdruck, Herzfrequenz, LDL-Cholesterin, Langzeitblutzucker und Gewicht ab. Diese blieben auf dem Smartphone der Anwender und könnten jederzeit gelöscht und verändert werden - ohne Einsicht Dritter.
Warum Dauerstress aufs Herz schlägt
Ein Herz und eine Seele sein: Dieser Satz gilt auch, wenn es um die Gesundheit geht. „Geht es der einen Seite nicht gut, leidet oft auch die andere darunter“, sagt der Mediziner Prof.
Volker Köllner. Manchmal reiche es deshalb nicht, bei der Behandlung nur die eine Seite zu berücksichtigen, so der Chefarzt für Psychosomatik am Reha-Zentrum Seehof in Teltow bei Berlin.
Dann ist es hilfreich, auch die Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen - wofür es mit der Psychokardiologie sogar eine eigene Spezialdisziplin in der Medizin gibt. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass die Gesundheit von Herz und Psyche eng miteinander verflochten sind. Depressionen etwa erhöhen das Risiko für einen Herzinfarkt fast so stark wie Rauchen.
„Wir wissen zudem, dass Stress, den Menschen sehr früh in ihrer Lebensgeschichte erfahren, ein Krankmacher ist“, sagt Köllner. Gewalt und sexuelle Misshandlungen in der Kindheit erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen - auch wenn diese sich womöglich erst Jahrzehnte später zeigen.
Unter Stress verkleben die Blutplättchen
Dass enormer Stress - eine Todesnachricht oder ein Jobverlust zum Beispiel - ganz unmittelbar auf das Herz schlagen kann, zeigt das Broken-Heart-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine akute Herzschwäche, bei der die Pumpleistung des Organs nachlässt. Viele Betroffene müssen auf der Intensivstation behandelt werden, wobei sich das Herz - anders als bei anderen Erkrankungen - wieder erholt.
Für das Herz wird Stress aber viel häufiger zum Problem, wenn er chronisch wird. Dabei sind es die körperlichen Stressreaktionen selbst, die dem Herzen auf Dauer schaden - obwohl sie aus einem cleveren Grund in uns angelegt sind.
„Stress ist ein Teil der menschlichen Überlebensstrategie“, sagt Prof. Christoph Herrmann-Lingen, Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen. „Ist Gefahr im Verzug, sorgt die Stressreaktion dafür, dass wir für Kampf oder Flucht bereit sind.“
Zentral ist dabei das vegetative Nervensystem, das lebenswichtige Funktionen wie den Herzschlag steuert. Unter Stress klopft unser Herz nicht nur schneller, um den Körper auf maximale Leistung einzustellen, auch die Blutplättchen verkleben stärker, um Blutungen besser stillen zu können.
„Der Körper stellt sich darauf ein, verwundet zu werden“, sagt Herrmann-Lingen, der auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Herzstiftung ist. Die unerwünschte Folge: So wird die Entstehung von verengten Herzkranzgefäßen begünstigt.
Das permanente Hochfahren des Herz-Kreislauf-Systems kann zudem zu Bluthochdruck führen, wodurch die Herzgefäße Schaden nehmen können.
Das Risiko für einen Herzinfarkt oder eine Herzinsuffizienz steigt.
Wie lässt sich dieser Teufelskreis bremsen?
Zunächst ist ein Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt sinnvoll, um die Befürchtungen mit der Realität abzugleichen. „Ein hilfreiches Angebot sind auch die vielen Herzsportgruppen“, sagt Volker Köllner.
Diese werden von Sportvereinen, Reha-Kliniken oder anderen Trägern angeboten. Wenngleich die Bewegung im Vordergrund steht: Der Austausch mit anderen Herzerkrankten tut auch der Seele gut.
Darüber hinaus kann eine Psychotherapie helfen, wieder Vertrauen in das eigene Herz zu fassen und die Körperwahrnehmung zu schulen. (dpa/tmn)